Informationen zur Landkarte Donau-Länder aus der Elke Rehder Collection
![]() zurück zum Antiquariat Liste Varia
zurück zum Antiquariat Liste Varia
About the Elke Rehder Collection https://de.wikipedia.org/wiki/Elke_Rehder
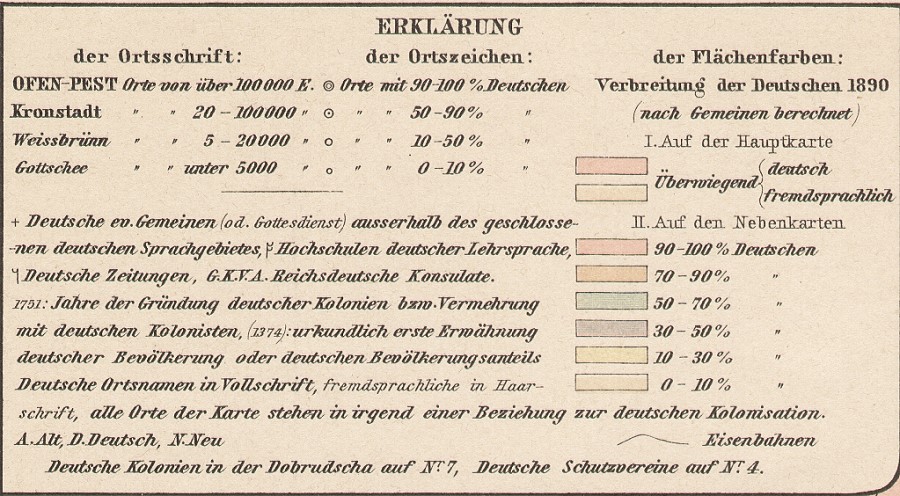
Donauländer
Als Donauländer werden jene Staaten bezeichnet, die Anteil am Einzugsgebiet
der Donau, dem Donauraum, haben. Speziell Donauanrainerstaaten nennt man
diejenigen, die Anrainer der Donau sind, also direkt am Strom liegen. Der mit
2900 Kilometern zweitlängste Strom Europas durchfließt insgesamt die zehn
Länder: Ukraine - Moldawien - Bulgarien - Rumänien - Serbien - Kroatien - Ungarn
- Slowakei - Österreich - Deutschland. Folgende weitere Staaten haben Anteile an
ihrem Einzugsgebiet: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Italien, Kosovo, Mazedonien,
Montenegro, Polen, Schweiz, Slowenien, Tschechien.
Die Donauländer haben trotz unterschiedlichen Sprachen und Kulturen viele
Gemeinsamkeiten, die geschichtlich bedingt sind: Über Jahrhunderte war die Donau
Grenze und Verbindung der griechisch-byzantinischen und römischen Antike mit den
Steppenvölkern, und dann sich bis heute entwickelnd des romanischen,
germanischen, slawischen Kulturraums, mit den heutigen Magyaren (Ungarn)
dazwischen.
Donauschwaben
Donauschwaben (auch Donaudeutsche) ist ein Sammelbegriff für die im 17. bis
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Länder der Stephanskrone
ausgewanderten Deutschen, aber auch eine geringe Anzahl von Franzosen, Spaniern
und Italienern, deren Siedlungsgebiete längs des Mittellaufs der Donau in der
Pannonischen Tiefebene lagen. Die Ansiedlungen beschränkten sich anfänglich auf
die Militärgrenze, einer Kette habsburgischer Militärbezirke entlang der Grenze
zum Osmanischen Reich. Diese Militärgrenze blieb bis Ende des 19. Jahrhunderts
kaiserliches Kronland, während die restlichen, jedoch größeren donauschwäbischen
Siedlungsgebiete der ungarischen Komitatsverwaltung eingegliedert wurden.
Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns als Folge des Ersten Weltkrieges wurden die
Siedlungsgebiete der Donauschwaben im ehemals österreich-ungarischen Reich durch
die alliierten Mächte dreigeteilt. Ein Teil verblieb bei Ungarn, der zweite Teil
wurde Rumänien zugeteilt und der dritte Teil fiel an den neu gegründeten Staat
Jugoslawien. Die Donauschwaben hatten um die rechtliche Gleichstellung als
Staatsbürger und um die Erhaltung ihrer kulturellen Traditionen zu kämpfen.
Die im Habsburgerreich in Südosteuropa angesiedelten Wehrbauern
unterschiedlichster Herkunft, Sprache, Religion und Tradition bestanden zum
größten Teil aus Lothringern (fast 25 Prozent), gefolgt von den Pfälzern und den
Elsässern. Nur etwa 6 Prozent der Siedler kamen tatsächlich aus Schwaben. Die
Sathmarer Schwaben stammen allerdings zum größten Teil aus dem Königreich
Württemberg in Oberschwaben, von wo sie in den Jahren 1712 bis 1815 von Graf
Alexander Karolyi und dessen Nachfahren gezielt angeworben wurden. Im Gegensatz
zur planlosen deutschen Auswanderung nach Übersee trug die vom Hause Habsburg
organisierte Ansiedlung eindeutig den Charakter der Gemeinschaftssiedlung. Bis
Ende des Ersten Weltkrieges waren die Donauschwaben als Ungarländische Deutsche
bekannt.
Der Begriff Donauschwaben hat eine überwiegend politische Entstehungsgeschichte.
Erst als sich nach dem Vertrag von Trianon 1920 ein landsmannschaftliches
Bewusstsein bei den Deutschen zu entwickeln begann, kam der Name Schwaben bei
ihnen selbst zur Geltung.
Neun Jahre nach der Schlacht am Kahlenberg bei Wien 1683, fünf Jahre nach der
Zweiten Schlacht bei Mohács 1687 und drei Jahre nach der Rückeroberung Ofens
(heute Buda, Teil von Budapest) 1689 erschien das erste Kaiserliche
Impopulationspatent „[…] zur besseren Auffhelfung, wieder Erhebung und
Bevölkerung derselben“. In mehreren kleineren und drei großen Schwabenzügen fand
die planmäßige Wiederbesiedlung der nach den Türkenkriegen größtenteils
entvölkerten pannonischen Tiefebene statt. Die österreichische
Ansiedelungspolitik (Politik von Prinz Eugen von Savoyen, Karl VI. und Claudius
Florimund Mercy, Kolonisierungs-Patent von Kaiserin Maria Theresia, das
Ansiedlungspatent von Kaiser Joseph II., und die Politik des letzten
römisch-deutschen Kaisers Franz II. (später als Franz I., Kaiser von Österreich)
begünstigte die Ansiedlung von Steuerzahlern.
Die vordergründigen Bedingungen für die Ansiedlung waren:
- Anerkennung des Kaisers aus dem Hause Habsburg als Oberhaupt
- katholischer Glaube (mit dem 1781 von Joseph II. erlassenen Toleranzpatent
wurde diese Bedingung aufgehoben)
- Verpflichtung zur Verteidigung der Militärgrenze
Innerhalb des Auswanderungsraumes ragten Lothringen, Elsass, die Pfalz, Rhein-
und Mainfranken besonders hervor. Die anderen Gebiete, aus denen die Auswanderer
kamen, waren Schwaben, Franken, Bayern, Hessen, Böhmen, Innerösterreich,
Österreichische Niederlande (heute: Luxemburg, Belgien), aber auch nicht
Deutschsprachige aus Italien, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Spanien
und der Ukraine siedelten in die Tiefebene. Im gesamten mittleren Donauraum
wurden die deutschen Siedler von ihren magyarischen, südslawischen und
rumänischen Nachbarn, wie auch von bulgarischen, slowakischen und tschechischen
Zuwanderern Schwaben genannt, obwohl diese Bezeichnung nur für einen kleinen
Teil der Ansiedler zutraf. In Teilen Ex-Jugoslawiens findet noch heute zur
umgangssprachlichen Bezeichnung von Deutschen der inoffizielle Begriff Švabo
oder Švaba Anwendung.
In Süddeutschland, Elsass-Lothringen und in Südserbien wurden Bauern und
Handwerker aus unterschiedlichen Gründen frei. Ziel der Habsburger war die
Wiederbelebung des Wirtschaftslebens in der damals wirtschaftlich brachliegenden
Vojvodina. Die Batschka und das Banat, hier in erster Linie die Militärgrenze,
waren die bevorzugten Siedlungsgebiete der von der Hofkammer geregelten
Ansiedlung. Diese Zielregionen waren wohl dünn besiedelt, jedoch nicht
menschenleer. Die ersten Siedler waren etwa 60–70.000 Serben (etwa 37.000
Familien), die 1690 während des Großen Türkenkrieges unter Führung des
Patriarchen von Peć, Arsenije III. Crnojević, auf Einladung Leopolds I. aus
türkisch besetzten Gebieten angesiedelt wurden. Hier wurden ihnen konfessionelle
und nationale Freiheiten in eigens dazu ausgegebenen Privilegien garantiert.
Neben der Ansiedlung auf staatlichen Kameralgütern fand auch eine Ansiedlung auf
privatem Grundbesitz statt. Die Ansiedlung verschiedener Bevölkerungsgruppen war
der gezielte Versuch der kaiserlichen Behörden, ihre jeweiligen Fähigkeiten für
den Wiederaufbau der verödeten und entvölkerten Landschaft zu nutzen. Sie
setzten damit bewusst auf die ethnische Vielfalt der Siedler, um sich ihre
unterschiedlichen kulturellen Traditionen bei der Erschließung der Landschaft
zunutze zu machen. Das bereits angespannte Verhältnis zwischen Serben und
Walachen auf der einen Seite und den Kolonisten auf der anderen Seite wurde
durch den generellen Widerspruch zwischen einer Weide- und Viehwirtschaft und
dem Ackerbau in allen Ansiedlungsformen noch verstärkt. Die mit dem
Zusammenleben verbundene gegenseitige Übernahme von materiellen ethnischen
Merkmalen und Bräuchen fand ihre Ergänzung im Wunsch nach stärkerer Abgrenzung
von fremden Ethnien. Die Verschiedenheit der Siedler wurde unter anderem auch
durch deren unterschiedliche Konfessionen und Vermögensverhältnisse verstärkt.
Allerdings ging die Abgrenzung von den walachischen und serbischen Nachbarn mit
einer Nivellierung der Unterschiede innerhalb des deutschsprachigen Teils der
Siedler einher, und sie entwickelten eigene ethnische Merkmale.
Die Hoffnungen der Siedler wurden in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft im Banat
bitter enttäuscht. Das ungewohnte Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern
und das mit den jahreszeitlich bedingten Überschwemmungen in den Niederungen
auftretende Sumpffieber machten den Kolonisten zu schaffen. Aufgrund der
Verschuldung des Kaiserreichs wurden ab 1778 Kameralgüter an private Grundherren
verkauft, wodurch die auf diesen Gütern siedelnden Kolonisten in ein
unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Grundherren gerieten. Der von
Vertretern der Donauschwaben hoch gehaltene und weit verbreitete Mythos „creatio
ex nihilo“ (deutsch Aufbauleistung aus dem Nichts) scheint trotz der extremen
Anfangsschwierigkeiten etwas einseitig ausgerichtet, da die slawischen Nachbarn
nicht weniger Widrigkeiten zu überwinden hatten.
Josephs II. Versuch, die deutsche Sprache zur Amtssprache zu machen, war der
Anfang einer nicht mehr endenden Auseinandersetzung um die Bedeutung der
verschiedenen Sprachen im Kaiserreich. Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen
war der Kampf um die eigene Sprache zu einem Symbol für den Kampf um ihre
Eigenständigkeit geworden. Zwischen 1867 und 1918, nach der Umwandlung des
Kaisertums Österreich zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, so wie in der Zeit
zwischen 1941 und 1944 während der Besetzung der Batschka, sollten die
ansässigen Deutschen, Slawen und andere nicht-ungarische Minderheiten
gleichermaßen magyarisiert werden.
Nachdem die Schwierigkeiten der ersten Kolonisationszeit überwunden worden
waren, hatte sich die Mehrheit der donauschwäbischen Siedlungen auf dem Land
erfolgreich entwickelt. Das bei den Donauschwaben verbreitete Prinzip, nur den
erstgeborenen Sohn erben zu lassen, verhinderte eine wie bei den anderen Ethnien
übliche Aufteilung ihrer Bauernhöfe in kleinere Parzellen. Die moderneren
Methoden der Donauschwaben, wie beispielsweise der intensive Ackerbau und die
Tierhaltung, wirkten sich auf Dauer produktiv auf die Entwicklung ihrer
Landwirtschaft aus, besonders in der Zeit der Auflösung der Grundherrschaft im
19. Jahrhundert und der damit verbundenen Kapitalisierung der Landwirtschaft.
Diese wirkte sich besonders für die besser entwickelteren Bauernhöfe günstig
aus. In der Folge kam es sowohl zu einer Vergrößerung des Landbesitzes
donauschwäbischer Bauern in den von ihnen mehrheitlich bewohnten Ortschaften als
auch zu Landkäufen in Gemeinden, die hauptsächlich von den anderen Ethnien
bewohnt wurden. So erreichte die Mehrheit der Donauschwaben auf dem Land einen
Wohlstand, der mit der Zeit deutlich über dem der benachbarten ethnischen
Gruppen lag.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wegen
der zunehmenden Bodenknappheit und der damit verbundenen Armut von Teilen der
Landbevölkerung zu einer vermehrten Auswanderung vor allem in die Vereinigten
Staaten von Amerika, an der auch viele Donauschwaben teilnahmen. Aufgrund ihrer
besseren wirtschaftlichen Situation nahmen die Donauschwaben insgesamt weniger
als andere ethnische Bevölkerungsgruppen an der Emigration teil. Es gab
allerdings regionale und soziale Schwerpunkte, so war die donauschwäbische
Bevölkerung in der Batschka und dem Banat überproportional an der Auswanderung
beteiligt und stellte dort über die Hälfte aller Auswanderer. Gleichzeitig gab
es aber auch Rückwanderungen von oftmals im Ausland zu Wohlstand gekommenen
ehemaligen Auswanderern. Auch hier waren die Donauschwaben aus der Batschka und
dem Banat überproportional vertreten, was sich in einer weiteren
wirtschaftlichen Stärkung von Teilen der donauschwäbischen Bevölkerungsgruppe
auswirkte.
Der donauschwäbische Siedlungsraum unterteilte sich in:
- das Siedlungsgebiet im südöstlichen Ungarischen Mittelgebirge zwischen Raab,
Donauknie und Plattensee, mit dem Zentrum Budapest mit Ausnahme Ost-Burgenlands;
- die Schwäbische Türkei (Baranja) südwestlich des Plattensees zwischen Donau
und Drau mit dem Zentrum Pécs (Fünfkirchen);
- Slawonien und Syrmien zwischen Save und Donau, mit dem Zentralort Osijek
(Esseg);
- die Batschka zwischen Donau und Theiß, mit dem Mittelpunkt in Novi Sad
(Neusatz);
- das Banat zwischen Marosch, Theiß, Donau und den Ausläufern der Südkarpaten
mit dem Zentrum in Timișoara (Temeswar);
- Sathmar in der nordöstlichen Großen Ungarischen Tiefebene, mit dem Mittelpunkt
Carei (Großkarol).
(Quelle Wikipedia)
Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster (dort bitte erneut auf das Bild klicken zur weiteren Vergrößerung)
Belgrad, Banat Komlos, Temeschwar, Werschitz, Gr. Betschkerek, Perjamosch, Alt Arad, Lippa, Lugosch / Verdeutsche französisch-lothringische Kolonien, Hatzfeld
Das Banat
Das Banat (deutsch: [baˈnaːt], serbokroatisch: [ˌbanaːt], rumänisch:
[baˈnat], serbisch-kyrillisch Банат, ungarisch Bánság) ist eine historische
Region in Mitteleuropa, die heute in den Staaten Rumänien, Serbien und Ungarn
liegt. Der Begriff Banat leitet sich vom Herrschaftsbereich eines Ban
(serb./kroat./ung. für Graf/Markgrafschaft) ab.
Das Banat liegt am Südostrand der ungarischen Tiefebene und ist von den Flüssen
Marosch im Norden, Theiß im Westen und Donau im Süden, sowie von den Südkarpaten
im Osten begrenzt. Im Nordosten – jenseits, bzw. rechts der Marosch – schließt
sich das Arader Gebiet an, welches teilweise zumindest kulturgeographisch auch
dem Banat zugeordnet werden darf.
Im Osten der Region liegt das Banater Bergland, das reich an Steinkohle und
Eisenerz ist. Im Westen wiederum finden sich fruchtbare Ebenen.
Infolge des Vertrags von Trianon wurde das Banat zwischen Rumänien (zwei
Drittel), Serbien (knapp ein Drittel) und Ungarn (ein geringer Zipfel im
Nordwesten) aufgeteilt. So trugen oder tragen einige neue Verwaltungsbezirke
heute noch den Namen der Region. Flächenmäßig hat das historische Banat mit
28.523 km² etwa die Größe Belgiens.
Das rumänische Banat besteht im Westen aus einem Teil des Pannonischen
Flachlandes („die Heide“), im nordöstlichen Teil aus Hügelland („die Hecke“) und
im Südosten aus den Karpaten (Banater Gebirge, Poiana-Ruscă- und
Retezat-Gebirge). Der serbische Teil besteht bis auf das Mittelgebirge Vršačke
Planine fast nur aus Flachland. Wirtschaftliches und kulturelles Zentrum ist die
Großstadt Timișoara (dt. Temeswar oder Temeschburg, ung. Temesvár).
Die Banater Schwaben
Die Banater Schwaben sind eine deutsche Bevölkerungsgruppe im Banat. Sie werden mit anderen deutschsprachigen Minderheiten aus dieser Region Südosteuropas unter dem Sammelbegriff Donauschwaben zusammengefasst. Ihre Vorfahren wurden von der Österreichischen Hofkammer seit Ende des 17. Jahrhunderts aus verschiedenen Teilen Süddeutschlands und aus Lothringen in der nach den Türkenkriegen teilweise entvölkerten und verwüsteten Pannonischen Tiefebene angesiedelt. Sie waren vor dem Ersten Weltkrieg auch als die „Ungarländischen Deutschen“ bekannt. Das Banat gehörte bis 1918 zusammen mit den anderen Siedlungsgebieten der Donauschwaben wie die westlich gelegene Batschka, die Schwäbische Türkei (heutiges Süd-Ungarn), Slawonien sowie die Region Sathmar (heutiges Nordwest-Rumänien, Kreis Satu Mare) zur Monarchie Österreich-Ungarn. Seit dem Ersten Weltkrieg bezeichnet man die Donauschwaben im rumänischen Teil des Banats als Banater Schwaben.
In der deutschsprachigen Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
wurde die Kolonisation des Banats häufig als ein durchgehend erfolgreich
umgesetztes Vorhaben der zuständigen österreichischen Behörden beschrieben. Der
Nutzen der Ansiedlung war wegen der Kosten in Regierungskreisen allerdings
umstritten und es kam zu vielfältigen Problemen. Die finanziellen und
materiellen Anreize zogen teilweise nur wenig arbeitswillige Kolonisten an, so
dass 1764 eigens Inspektoren beauftragt wurden, das Verhalten der Ansiedler zu
überwachen.
1744 bis 1768 gab es noch eine zusätzliche Form der Ansiedlung, den Temesvárer
Wasserschub: zweimal jährlich wurden Landstreicher, liederliche Weibspersonen,
Wilderer, Schmuggler und aufsässige Bauern aus ihren Heimatregionen verbracht
und zur moralischen Läuterung im Banat angesiedelt. Der Wasserschub hatte einen
schlechten Ruf und erschwerte das Anwerben von Kolonisten.
Auf seiner Inspektionsreise durch das Banat 1768 stellte Kaiser Joseph II. in
seinen Reiseaufzeichnungen zahlreiche gravierende und von der Verwaltung der
Provinz zu verantwortenden Mängel und Missstände fest. Zu diesen zählte neben
der Korruption auch die schlechte Wahl der Standorte und teilweise Übergröße der
Dörfer, der Mangel an Holz und Wasser sowie die Baufälligkeit vieler
Kolonistenhäuser.
1772 wurden von Maria Theresia Anordnungen veranlasst, die eine Vielzahl von
Einzelheiten der Ansiedlung regelten, so zum Beispiel die Gestaltung der Dörfer,
die Größe des zuzuteilenden Landes und die Besoldung von Lehrern und
Bürgermeistern.
Dörfer, Städte und Straßen wurden auf dem Reißbrett entworfen und spiegelten in
ihrer Symmetrie die damalige absolutistische Baukultur wider. Die Ansiedler
fanden das Banat als nahezu menschenleere, von Wäldern durchzogene
Sumpflandschaft vor. Seuchen (darunter die Pest), Fieberkrankheiten und Hunger
begleiteten die Ankömmlinge in den ersten Jahren. Doch innerhalb von zwei bis
drei Generationen gelang die Rekultivierung des Landstrichs – ein enormer
Kraftakt, der von vielen Rückschlägen wie Kriege, Seuchen, Hunger und
zahlreichen einhergehenden Opfern begleitet war. Der Spruch „Den Ersten der Tod,
den Zweiten die Not, den Dritten das Brot“ hat sich unter den Banater Schwaben
zur Charakterisierung der Aufbauleistung überliefert. Entscheidend für das
Gelingen war die Eindämmung der Sümpfe durch die Kanalisation des mehrarmigen
Flusses Bega. Der gewonnene Ackerboden aus Schwarzerde erwies sich als äußerst
fruchtbar und begründete den relativen Wohlstand der Banater Schwaben im 19.
Jahrhundert. Der Landstrich galt als Kornkammer Österreich-Ungarns. Die Festung
Temeswar wurde zur blühenden Stadt und zum kulturellen Zentrum der Banater
Schwaben. (Quelle Wikipedia)
![]() nach oben
nach oben
Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster (dort bitte erneut auf das Bild klicken zur weiteren Vergrößerung)
Slawonien, Batschka, Schwäbische Türkei / Maria Theresienstadt, Esseg, Fünfkirchen, Kaposvar, Apatin, Vukovar, Palanka, Futak, Neusalz
Die Batschka
Die Batschka (serb. / kroat. Bačka, serb. kyrill. Бачка, ungar. Bácska,
slowak. Báčka, russinisch Бачка) ist eine Region in Mitteleuropa bzw. in
Südosteuropa. Die Batschka ist zwischen den Staaten Serbien und Ungarn
aufgeteilt, wobei der südliche und größte Teil zu Serbien gehört und sich in
drei Bezirke der autonomen Provinz Vojvodina unterteilt. Der nördliche Teil
dagegen gehört zu Ungarn und bildet den südlichen Teil des Komitats Bács-Kiskun.
Die Batschka ist größtenteils ein fruchtbares Flachland, das im Westen und im
Süden von der Donau und im Osten von der Theiß begrenzt wird.
Ab dem 19. Jahrhundert wurden die Schiffahrts-Kanäle in der Batschka errichtet,
die einerseits zur Bewässerung der fruchtbaren Ackerböden, andererseits als
Binnenschifffahrtswege zwischen Donau und Theiß dienten.
Mitte des 19. Jahrhunderts erhoben sich die Ungarn gegen die Habsburger, u. a.
wegen der Zugeständnisse, die die Habsburger den Serben auf Kosten ungarischer
Ansprüche gewährten. Diese Situation nutzten die Serben für sich aus, um im Jahr
1848 die Serbische Woiwodina zu proklamieren mit dem Verweis auf von den
Habsburgern gewährte Autonomierechte, die man sich im Kampf gegen das
mittlerweile kontinuierlich untergehende Osmanische Reich erkämpft hatte. Das
serbische De-facto-Regime konnte sich von 1848 bis 1860 behaupten. Nach der
Einigung zwischen Ungarn und dem Habsburgerhaus, dem „Ausgleich“, wurde die
Batschka Ungarn zugesprochen, jegliche Autonomie aberkannt und die Serbische
Woiwodina geteilt.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918 gehörte die gesamte Region
damit zu Ungarn als Teil Österreich-Ungarns. Wegen der rigorosen
Assimilierungspolitik aufgrund der Bevölkerungsverhältnisse auf Kosten der
nicht-ungarischen Bevölkerung und des immer rapider erstarkenden Serbiens
südlich der Donau kam es öfters zu Aufständen der nicht-ungarischen Bevölkerung.
Nach der Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg wurde der größte Teil
der Batschka Serbien zugeschlagen. Der nördliche kleinere Teil verblieb bei
Ungarn. Diese Teilung musste Ungarn mit dem Friedensvertrag von Trianon vom 4.
Juni 1920 widerwillig anerkennen.
Im nördlichen Teil wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit der „Sozialistischen
ungarisch-serbischen Republik Batschka und Branau/Baranya“ eine kommunistische
Räterepublik ausgerufen. Nach einem erfolglosen Versuch, die Unterstützung der
Serben im südlichen Teil zu gewinnen, lösten rumänische sowie serbische Truppen
die Räterepublik auf. (Auszug aus Wikipedia)
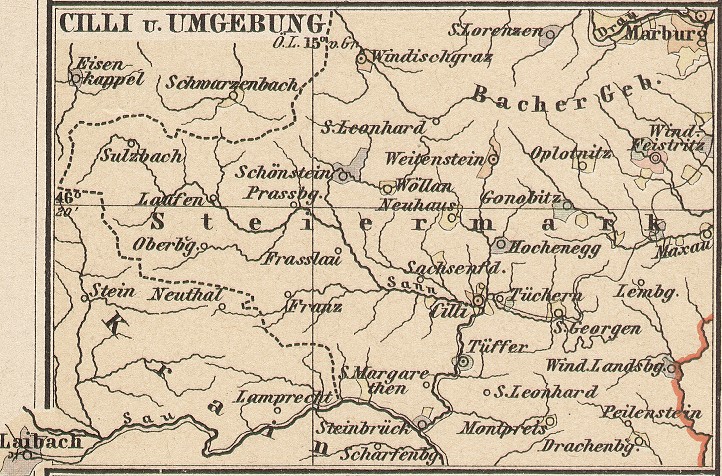
Laibach an der Sau, Eisenkappel, Cilli, Tüffer, Steinbrück, Schönstein, Weitenstein, Hochenegg, Marburg an der Drau
Cilli im Kaisertum Österreich, Herzogtum Steiermark
Am 27. April 1846 bekam Cilli durch die Eröffnung der Österreichischen Südbahn
(Wien–Triest) Anschluss ans Eisenbahnnetz.
Ende 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war Cilli ein Zentrum nationalistischer
Konflikte zwischen Deutschen und Slowenen. 1895 wurde erstmals an einer
Sekundarschule in Cilli auf Slowenisch unterrichtet. Die Volkszählung 1910 wies
66,8 % der Cillier Bevölkerung als Deutsche aus. Am 15. Mai 1907 wurde das 1906
errichtete Deutsche Haus eröffnet, in dem deutsche Vereine und Firmen ihren Sitz
hatten. Die Stadt erhielt 1902 Anschluss ans Telefonnetz und 1913 ans
Elektrizitätsnetz.
1918 kam Celje wie die gesamte überwiegend von Slowenen bewohnte Untersteiermark
zum neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, seit 1929
Jugoslawien. Das Deutsche Haus wurde 1919 enteignet und erhielt den Namen
Celjski dom („Cillier Haus“).
Der Gerichtsbezirk Cilli wurde durch eine 1849 beschlossene Kundmachung der
Landes-Gerichts-Einführungs-Kommission geschaffen und umfasste ursprünglich die
24 Gemeinden Cilli, Doberna, Greis, Großpiereschitz, Guttendorf, Hochenegg,
Kostrinitz bei Montpreis, Lemberg bei Neuhaus, Neukirchen, Pletrovitsch, Rann,
Sachsenfeld, St. Martin im Rosenthale, St. Achazius, St. Georgen bei Reichenegg,
St. Lorenzen in Pröschin, St. Paul bei Pragwald, St. Peter im Sannthale, St.
Primus, St. Rosalia, Sternstein, Swetina, Tüchern und Weixeldorf. Der
Gerichtsbezirk Cilli bildete im Zuge der Trennung der politischen von der
judikativen Verwaltung ab 1868 gemeinsam mit den Gerichtsbezirken Franz,
Gonobitz, Oberburg, Sankt Marein bei Erlachstein und Tüffer den Bezirk Cilli.
Der Gerichtsbezirk wies 1910 eine Bevölkerung von 49.379 Personen auf, von denen
4.627 Deutsch (9,4 %) und 42.157 Slowenisch (85,4 %) als Umgangssprache angaben.
Durch die Grenzbestimmungen des am 10. September 1919 abgeschlossenen Vertrages
von Saint-Germain wurde der Gerichtsbezirk Cilli großteils dem Königreich
Jugoslawien zugewiesen.
Der Gerichtssprengel Cilli umfasste vor seiner Auflösung die 22 Gemeinden
Bischofdorf (Škofja vas), Cilli, Cilli Umgebung (Celje okolica), Doberna,
Großpireschitz (Velika Pirešica), Gutendorf (Gutovlje), Hochenegg (Vojnik),
Kalobje, Neukirchen (Nove cerkev), Pletrowitsch (Petrovče), Sachsenfeld (Žalec),
Sankt Georgen an der Südbahn (Sveti Jurij ob južni železnici), Sankt Georgen an
der Südbahn Umgebung (Sveti Jurij ob južni železnici okolica), Sankt Lorenzen
bei Proschin, Sankt Martin im Rosenthale (Sveti Martin v Rožni dolinini), Sankt
Paul bei Pragwald (Sveti Pavel pri Pregboldu), St. Peter im Sannthale (Sveti
Peter ob Savinji), Svetina, Trennenberg (Dramlje), Tüchern (Teharje) und
Weixeldorf (Višnjaves). (Quelle Wikipedia)
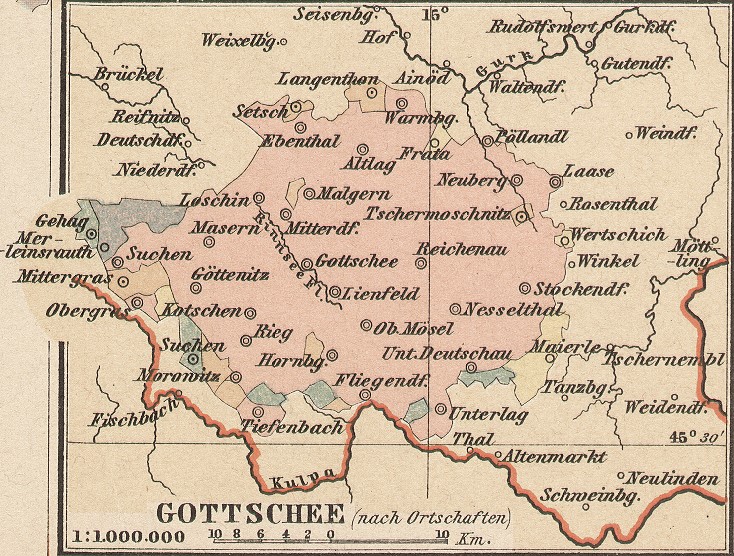
Tiefenbach, Obergras, Mittergras, Gehag, Thal, Masen, Göttenitz, Lienfeld, Malgern, Altlag, Neuberg, Laase, Stockendorf, Nesselthal, Ober Mösel, Unter Deuschau, Fliegendorf
Gottscheer
Als Gottscheer (Göttscheabar, Mehrzahl Göttscheabarə, slowenisch: Kočevarji)
wird die ehemalige deutschsprachige Bevölkerung des Gottscheer Landes (Kočevska)
im Herzogtum Krain (heute: Slowenien) bezeichnet, einer deutschen Sprachinsel,
deren Zentrum die Stadt Gottschee (Göttscheab, slowen. Kočevje) war. Das
Siedlungsgebiet umfasste eine Fläche von ungefähr 860 km² mit 177 Ortschaften.
Die Gottscheer, die teils als Bauern von der Landwirtschaft, teils als
umherziehende Krämer in sehr einfachen Verhältnissen lebten, bewahrten ihren
altertümlichen oberdeutschen Dialekt, das Gottscheerische, sechs Jahrhunderte
lang bis zu ihrer Umsiedlung unter den Nationalsozialisten 1941.
Von 1809 bis 1814 war die Gottschee unter der Herrschaft Napoleons und gehörte
als Teil von Krain zu den illyrischen Provinzen. Danach wurde die Herrschaft der
Habsburger wieder hergestellt. 1848 erfolgte die Aufhebung der Leibeigenschaft.
1872 wurde das Gymnasium in der Stadt Gottschee gegründet. 1882 erfolgte die
Gründung der Fachschule für Holzbearbeitung. 1893 erhielt die Gottschee durch
die Errichtung der Stichbahn Laibach–Gottschee Anschluss ans Eisenbahnnetz.1894
ließen die Auersperger im Hornwald ein Sägewerk errichten, das bald darauf 400
Arbeiter beschäftigte. Das Werk erhielt Anschluss an eine Schmalspurbahn, die
auch Teile des Hornwaldes mit seinen Waldungen erschloss.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zwischen 1869 und 1878, hatte die
Zahl der Gottscheer mit etwa 26.000 ihren Höhepunkt erreicht. Die Armut trieb
sehr viele zur Auswanderung in die USA. Nach 1918 kam im Königreich Jugoslawien
der politische Druck gegen die deutsche Minderheit dazu. So betrug die Zahl der
Gottscheer Deutschen 1941 nur noch 12.500.
Mit der Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 1918, des
späteren Jugoslawiens, wurden die Gottscheer zu einer ethnischen Minderheit. Die
deutschen Ortsnamen in der Gottschee wurden offiziell durch slowenische Namen
ersetzt. Durch Regierungserlass vom 16. November 1918 wurde an den bisher
deutschsprachigen Volksschulen, Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen
Slowenisch als einzige zulässige Unterrichtssprache eingeführt. Zugelassen
blieben Parallelklassen mit deutscher Unterrichtssprache, an denen jedoch keine
Kinder mit slawischem Familiennamen teilnehmen durften. Mindestens 40
zugelassene Anmeldungen waren für einen deutschsprachigen Klassenzug
erforderlich. Infolgedessen ging auch das Gymnasium in Gottschee zur
slowenischen Unterrichtssprache in allen Klassen über. Auch an sämtlichen
Volksschulen der Gottschee wurde das Slowenische die Hauptsprache.
Österreichische Beamte, Lehrer und Professoren deutscher Nationalität wurden per
Verordnung vom 16. Dezember 1918 entlassen. Die Fachschule für Holzbearbeitung
wurde geschlossen. In der Gottschee gab es 1935 nur noch 21 deutschsprachige
Klassen oder Teilklassen, wobei insgesamt 37 Schulen bestanden. (Quelle
Wikipedia)
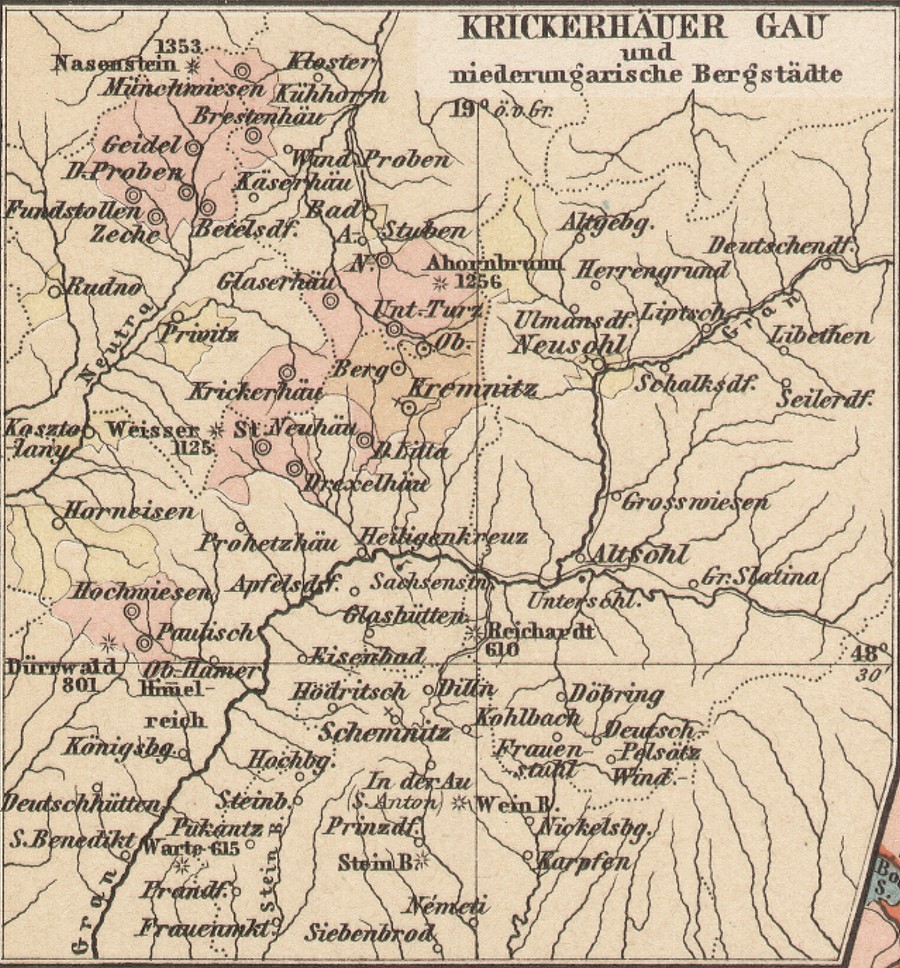
Gran, Hochmiesen, Kremnitz, Berg, Krickerhäu, Neusohl, Altsohl, Unter-Turz, Neutra, Ahornbrunn, Zeche, Betelsdorf, Fundstollen, Brestenhäu, Proben
Krickerhau
Handlová (deutsch Krickerhau, ungarisch Nyitrabánya – bis 1907 Handlova) ist eine Stadt in der Slowakei. Sie liegt am Fluss Handlovka im Oberneutraer Kessel (Hornonitrianska kotlina), vom Žiar-Gebirge und vom Vogelgebirge umgeben, 15 km von Prievidza und 20 km von Žiar nad Hronom entfernt.
Karpatendeutsche
Als Karpatendeutsche (früher auch: Mantaken) bezeichnet man deutschstämmige
Menschen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei sowie im östlichen Karpatenbogen,
der heute territorial zur Ukraine gehörigen Karpatoukraine. Der Name
Karpatendeutsche stammte vom Historiker Raimund Friedrich Kaindl. Zunächst
wurden darunter alle Deutschen in den Kronländern Galizien und Bukowina, der
ungarischen Hälfte der k.u.k. Doppelmonarchie, Bosnien und Herzegowina sowie
Rumänien gezählt. Mit den territorialen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg
wurde diese Definition allerdings unüblich. Seitdem bezeichnen sich nur noch die
Deutschen in der damaligen Slowakei (mit der Karpatoukraine) als
Karpatendeutsche.
Deutsche Siedler haben die Slowakei vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, vor allem
jedoch nach dem Mongoleneinfall von 1241, besiedelt. Ihren Höhepunkt nahm die
Besiedlung im 14. Jahrhundert. Im Gebiet von Pressburg (Bratislava) gab es wohl
auch schon etwas früher Deutsche. Sie haben vor allem ältere slowakische Städte
(v. a. Pressburg), Markt- und Bergbausiedlungen besiedelt und wurden meist von
den Königen als Spezialisten (Handwerker, Bergleute) angeworben. Ungefähr bis
zum 15. Jahrhundert bestand die Führungsschicht aller slowakischen Städte fast
ausschließlich aus Deutschen. Die drei Hauptsiedlungsgebiete waren Bratislava
und Umgebung, die deutschen Sprachinseln in der Zips sowie das Hauerland. Hinzu
kamen ab dem 18. Jahrhundert in der Karpatoukraine im Tereschwa- bzw. Mokrantal
sowie bei Munkatsch noch zwei weitere kleine deutsche Sprachinseln. Zusammen
stellten die Bewohner der fünf Siedlungsgebiete aber keine homogene Gruppe dar,
oftmals hatten sie nicht einmal Kenntnis voneinander.
Die zahlenmäßig größte Gruppe der Deutschen im Habsburger Reich lebte in der
Stadt Pressburg, die bis ins 20. Jahrhundert hinein noch mehrheitlich deutsch
geprägt war. Bei der Volkszählung im Sommer 1919 waren Deutsche noch die größte
Gruppe: Ihr gehörten 36 % der Bürger an, 33 % waren Slowaken und 29 % Ungarn.
Zwar waren die Karpatendeutschen genauso wie viele Slowaken in der zweiten
Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einem starken
Magyarisierungsdruck ausgesetzt, aber in zahlreichen Orten stellten die
Deutschen immer noch die Bevölkerungsmehrheit. Nach dem Ende des ersten
Weltkrieges plädierten die meisten Karpatendeutschen für den Verbleib der
Slowakei bei Ungarn, danach für eine slowakische Autonomie innerhalb der
Tschechoslowakei. Nach 1918 veränderte sich die Situation für die
Karpatendeutschen grundlegend, denn mit der Erhebung Pressburgs zur
Landeshauptstadt und dem Zustrom an Slowaken wurden sie, trotz Wegzug vieler
Ungarn, zu einer Minderheit in der Bevölkerung. In den anderen Siedlungsgebieten
ging es ähnlich vonstatten.
Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster
Bakonywald, Schildberge, Raab, Herend, Marko, Stuhlweissenburg, Fleischhauer Strasse, Budaörs, I. Tschepel, S. Andräl, Taath, Csolnok, Schanibeck, Wereschwar, Scholmar, Taksony
Ungarndeutsche
Der Begriff Ungarndeutsche ist aus mehreren Gründen unscharf. Heute nennen
sich jene deutschsprachigen Menschen in Ungarn so, die sich zu den
Donauschwaben, einer ethnischen Minderheit in Ungarn, zählen.
„Ungarndeutsche“ nennt man allgemein die Nachfahren der einst ins Karpatenbecken
eingewanderten Deutschen. Der Begriff Ungarndeutsche kann historisch auch
Bevölkerungsgruppen außerhalb des heutigen Ungarn einschließen, da das
Königreich Ungarn mit dem Vertrag von Trianon (1920) wesentlich verkleinert
wurde, als große Gebiete Ungarns an die Nachbarstaaten fielen.
Zu beachten ist auch, dass sich in der Vergangenheit nicht alle
deutschsprachigen Volksgruppen in gleicher Weise und Intensität mit dem
ungarischen Staat identifizierten. Zumeist bezeichnet im heutigen Sprachgebrauch
der Begriff „Ungarndeutsche“ daher nur einen Teil der deutschsprachigen
Bevölkerungsgruppen im ehemaligen Königreich Ungarn.
Historisch wanderten die Deutschen in mehreren Wellen zu verschiedenen Zeiten in
das Karpatenbecken ein. Es entstanden auf dem Gebiet des damaligen Ungarn
deutsche Sprach- und Siedlungsgebiete.
Die größte Einwanderungswelle ins ungarische Tiefland erfolgte nach der
Türkenherrschaft. Zwischen 1700 und 1750 kamen deutsche Siedler aus
Süddeutschland, Österreich und Sachsen in die nach den Türkenkriegen zum Teil
menschenleeren Gebiete Pannoniens, des Banat und der Batschka und trugen
entscheidend zur wirtschaftlichen Erholung und kulturellen Eigenart dieser
Regionen bei.
Ende des 18. Jahrhunderts lebten im damaligen Vielvölkerstaat Königreich Ungarn
mehr als eine Million Deutsche, die vor allem in der Landwirtschaft tätig waren.
Es gab aber auch eine blühende deutsche Kultur mit literarischen Werken,
Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern in den Städten. Ein großes deutsches
Theater wurde am 9. Februar 1812 in der Hauptstadt eröffnet. Vor dem Ersten
Weltkrieg lebten etwa 1,5 Millionen Donauschwaben im Königreich Ungarn, deren
Siedlungsgebiete 1919 zwischen den Staaten Ungarn, Jugoslawien und Rumänien
aufgeteilt wurde. (Quelle Wikipedia)
![]() nach oben
nach oben
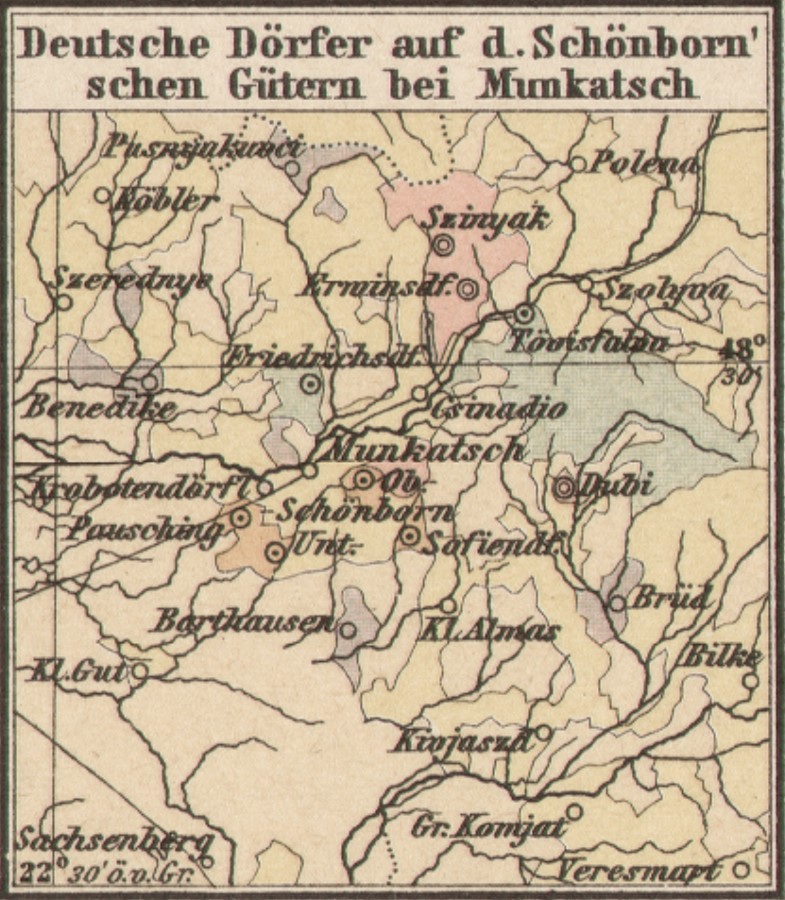
Gut Schönborn, Munkatsch, Erminsdorf, Szinyak, Fridrichsdorf, Pausching, Safiendorf, Dubi
Schönbornsche Güter in Munkatsch
Mukatschewe (ukrainisch Мукачеве) ist eine Stadt in der westukrainischen
Oblast Transkarpatien. Mukatschewe ist der Sitz des Verwaltungszentrums für den
Rajon Mukatschewe, ein Weinbaugebiet, und liegt am Fluss Latorica, 250 km
südwestlich von Lemberg. Mukatschewe liegt nahe der Grenze zu Polen (200 km),
Slowakei (90 km), Ungarn (40 km) und Rumänien (110 km). Die bekannteste
Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Burg Palanok, die im 14. Jahrhundert auf dem
Lankova errichtet wurde. Im Rahmen des Königreichs Ungarn gehörte die Stadt zum
Komitat Bereg.
Die Burg von Munkács (heute Burg Palanok) ließ, wie die meisten Burgen in dieser
Gegend, der ungarische König Béla IV. im 13. Jahrhundert nach dem
Mongoleneinfall erbauen, um die östlichen Grenzen Ungarns zu schützen. 1445
wurde die Stadt zu einer königlichen Freistadt erklärt. Berühmtester Inhaber der
Burg war die Familie Rákóczi. Nach dem Ende des von Ferenc II. Rákóczi
angeführten ungarischen Aufstands gegen die Habsburger (1711 Frieden von
Sathmar) verloren die Rákóczis die Burg. 1726 übertrugen dann die Habsburger die
Burg samt der Stadt und Umgebung an die österreichische Familie Schönborn, die
auch viele Deutsche in Munkács ansiedelte. In dieser Zeit expandierte die Stadt
flächenmäßig und wirtschaftlich.
In der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde die Stadt stets mit ihrem
ungarischen Namen Munkács bezeichnet. Kaiser Karl VI. gab Mukatschewe und
Tschynadijowo 1726 an den Bischof Lothar Franz von Schönborn. Ein Jahr später
fiel es an dessen Neffen Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim. Der Besitz
zählte zu den größten in Osteuropa und bestand 1731 aus 4 Städten und 200
Dörfern mit einer Gesamtfläche von 2.400 Quadratkilometern. Er blieb bis ins 20.
Jahrhundert im Besitz der Grafen von Schönborn. (Quelle Wikipedia)
![]() nach oben
nach oben
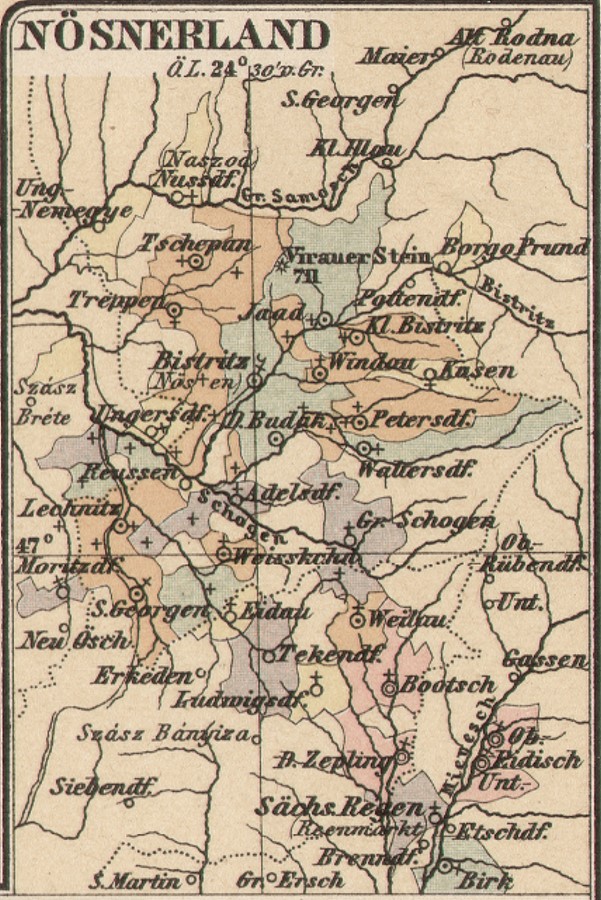
Tschepun, Treppen, Klein Bistritz, Windau, Dudak, Lechnitz, St. Georgen, Sächsisch Regen, Birk, Ober Eidisch, Petersdorf, Schagen, Gr. Samosch
Nösnerland in Nord-Siebenbürgen
Das Nösnerland (auch Nösnergau) ist eine historische Region in
Nord-Siebenbürgen angrenzend an das Reener Ländchen. Es ist der nördlichste
Ausläufer des Königsbodens, zwischen den Flüssen Bistritz und Marosch. Der
Hauptort des Gebietes war die Stadt Bistritz. Bis 1944 war das Nösnerland
mehrheitlich von Siebenbürger Sachsen bewohnt, die allerdings mit dem Abzug der
deutschen Wehrmacht evakuiert wurden und nach Österreich und Westdeutschland
flüchteten. Heute ist das Nösnerland Teil des Kreises Bistrița-Năsăud und hat
eine überwiegend rumänische Einwohnerschaft. (Quelle Wikipedia)
Historische Orte im Nösnerland sind:
Baierdorf
Billak
Bistritz
Botsch
Burghalle
Deutsch-Budak
Dürrbach
Großeidau
Groß-Schogen
Heidendorf
Jaad
Jakobsdorf (Nösnerland)
Kallesdorf
Kirieleis
Klein-Bistritz
Kuschma (Auen)
Lechnitz
Mettersdorf
Minarken
Moritzdorf
Mönchsdorf
Oberneudorf
Paßbusch
Pintak
Sankt Georgen
Schönbirk
Senndorf
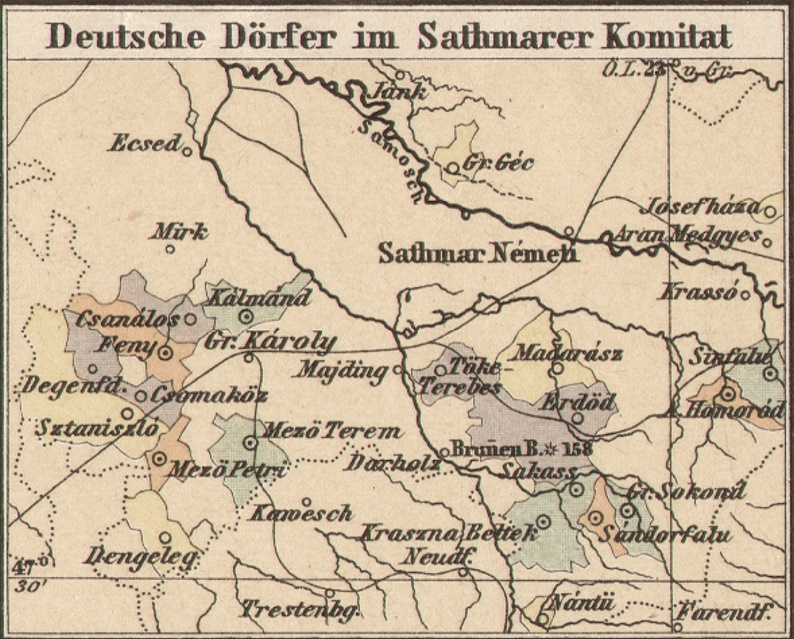
Sathmar Németi, Samosch, Gr. Károly, Mezö Petri, Kraszna Beltek, Sakass, Sandorfalu, Sinfalu, Homoród; Feny
Deutsche im Komitat Sathmar
Das Komitat Sathmar (ungarisch Szatmár vármegye; lateinisch comitatus
Szathmariensis) war eine Verwaltungseinheit (Komitat/Gespanschaft) im Königreich
Ungarn. Heute liegt der kleinere Teil (etwa 1/4 des Gebiets) im Nordosten
Ungarns, der größere Teil (etwa 3/4 des Gebiets) im Nordwesten Rumäniens (im
heutigen Kreis Satu Mare). Ein kleiner Teil um den Ort Welyka Palad (damals
ungarisch Nagypalád) gehört heute zur Ukraine (in der Oblast Transkarpatien).
Das Komitat grenzte im Norden an das Komitat Bereg, im Nordosten an das Komitat
Ugocsa, im Osten an das Komitat Máramaros, im Südosten an das Komitat
Szolnok-Doboka, im Süden an das Komitat Szilágy und im Westen an das Komitat
Szabolcs.
Es lag südlich der Theiß und wurde vom Samosch (heute rumänisch Someș)
durchflossen. 1910 hatte es 396.600 Einwohner auf einer Fläche von 6.287 km².
Das Komitat war bis 1918 Teil des Königreichs Ungarn und wurde dann zwischen
Ungarn und Rumänien (in den Kreis Satu Mare eingegliedert) aufgeteilt. 1921 kam
ein kleiner Teil um Welyka Palad durch einen Gebietstausch zur neu entstandenen
Tschechoslowakei (als Teil der Karpatenukraine). Der bei Ungarn verbliebene Teil
wurde mit den benachbarten Rumpfkomitaten zum Komitat Szatmár-Ugocsa-Bereg
vereinigt. Aus diesem ging 1950 das Komitat Szabolcs-Szatmár hervor, das 1990 in
Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg umbenannt wurde. (Quelle Wikipedia)
Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster
Unterwald, Mieresch, Broos, Strassburg (Egidstadt), Donersmarkt, Hermannstadt, Klein Schelken, Kochel, Burzenländer Gebirge, Kronstadt, Burzenland, Petersberg, Honigberg, Schuler Gebirge, Geisterwald, Alt, Köngsboden, Weisskirch, Waldhütten, Leschkirch, Reussdorf
Siebenbürger Sachsen
Die Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit im heutigen
Rumänien. Sie stammt aus dem Landesteil Siebenbürgen und ist die älteste noch
existierende deutsche Siedlergruppe in Osteuropa. Ihr Siedlungsgebiet hatte nie
Anschluss an reichsdeutsches Territorium, sondern gehörte zum Königreich Ungarn,
zum Fürstentum Siebenbürgen und zur Habsburgermonarchie.
Während 1930 etwa 300.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen lebten, waren es
im Jahr 2007 noch knapp 15.000. Die Mehrheit der Bevölkerung wanderte seit den
1970er Jahren und in einem großen Schub ab 1990 in die Bundesrepublik
Deutschland aus. Organisierte Gemeinschaften Siebenbürger Sachsen leben in
nennenswerter Anzahl auch in Österreich sowie in Übersee in Kanada und den USA.
Die Siebenbürger Sachsen siedelten in drei nicht zusammenhängenden Gebieten des
mittelalterlichen Fürstentums Siebenbürgen: Altland, Nösnergau und Burzenland.
Untergliedert wurden diese in noch kleinteiligere Verwaltungseinheiten, die bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein Bestand hatten.
Daneben gab es noch weitere inoffizielle sächsische Regionsbezeichnungen, die
aber nicht zwingend mit den Verwaltungseinheiten übereinstimmten, z. B.
Weinland, Repser Ländchen, Unterwald, Reener Ländchen, Krautwinkel, Harbachtal
usw.
Die alten Gebietskörperschaften orientierten sich an der ethnischen und
rechtlichen Zugehörigkeit der sächsischen Bewohner und bildeten zusammen den
Königsboden. Allerdings entspricht dieser nicht den heutigen Grenzen der Kreise
Hunedoara, Alba, Hermannstadt, Kronstadt, Mureș und Bistritz, die alle Teile des
Königbodens enthalten.
Ende des 17. Jahrhunderts gelangte Siebenbürgen unter habsburgische Herrschaft
und wurde Kronland (Österreich).
Etwa ein Jahrhundert später, Ende des 18. Jh. erklärte Kaiser Joseph II. im Zuge
seiner „Revolution von oben“ alle im Goldenen Freibrief fixierten Rechte für
null und nichtig. Die ständische Verfassung der Nationsuniversität und die
jahrhundertealte Autonomie des Königsbodens wurden aufgehoben. Kurz vor seinem
Tod machte er die Reformen allerdings wieder rückgängig.
1848 griff die Wiener Märzrevolution auf Siebenbürgen über. Die ungarischen
Aufständischen besetzten Siebenbürgen und versuchten erneut, die Autonomie der
Sachsen abzuschaffen. Mit russischer Hilfe gelang es Österreich 1849, die
ungarischen Revolutionäre zu schlagen und Siebenbürgen zurückzuerobern. Die
alten Rechte wurden kurzzeitig wieder hergestellt.
Durch den Österreichisch-Ungarischen Ausgleich fiel Siebenbürgen 1867 Ungarn zu,
worauf die Nationsuniversität, als Selbstverwaltungsorgan, endgültig aufgehoben
wurde. Der ungarische Staat traf im Folgenden zahlreiche Maßnahmen zur
Magyarisierung der verschiedenen Minderheiten im Staatsgebiet. (Quelle
Wikipedia)
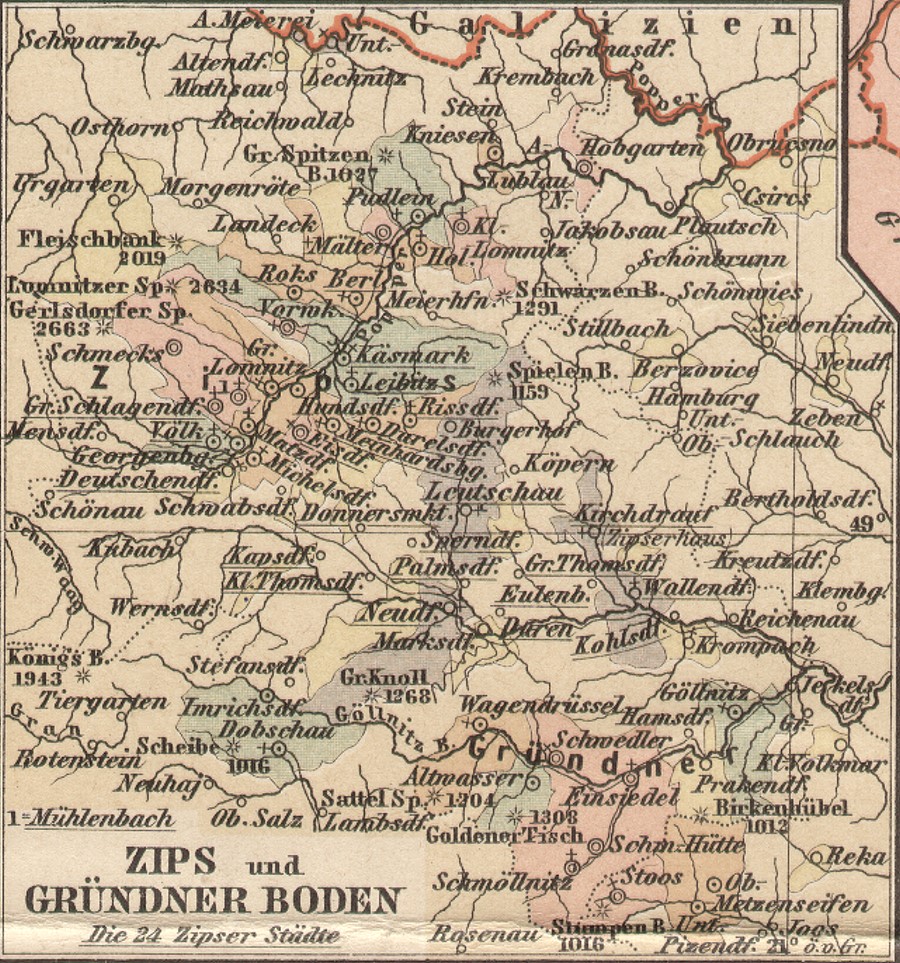
Groß Schlagendorf, Deutschendorf, Kapsdorf, Thomsdorf, Neudorf, Mühlenbach, Göllnitz, Kohlsdorf, Eulenburg, Leutschau, Donnersmarkt, Meinhardsburg, Durelsdorf, Rissdorf; Leibitz, Käsmark, Berl, Mälter, Pudlein, Hobgarten, Eisdorf
Zipser Deutsche
Die Zips (slowakisch: Spiš; ungarisch: Szepes; polnisch: Spisz; lateinisch:
Scepusium) ist eine Landschaft in der nordöstlichen Slowakei. Von ihr leitet
sich der Name des ehemaligen ungarischen Komitats Zips ab.
Das Gebiet liegt in der nordöstlichen Slowakei auf der Fläche der Hohen Tatra
und im Gebiet östlich davon. Die südliche Grenze bilden die Niedere Tatra und
das Slowakische Erzgebirge (slowakisch Slovenské rudohorie), im Westen grenzt
die Zips an die traditionell als Liptau (slowakisch Liptov) bekannte Landschaft.
Die Zips ist größtenteils um die Flüsse Poprad (deutsch = Popper) und Hernad
(slowakisch Hornád) (nur bis Jaklovce) gelegen. Ein kleiner Teil des Gebietes
liegt seit 1918 in Polen. Die meisten Zipser Städte haben ihren Ursprung in
deutschen Siedlungen (in der Unterzips vor allem Bergbausiedlungen), für die ab
dem 12. Jahrhundert, insbesondere nach dem Mongoleneinfall 1242, deutsche
Spezialisten und Bergleute aus Schlesien, Sachsen und Thüringen von den
Ungarnkönigen ins Land geholt wurden.
Die Bewohner der Zips schufen im 13. Jahrhundert eine eigene geistliche
Organisation, die Bruderschaft der 24 königlichen Pfarrer, und parallel dazu die
politische Organisation Bund der 24 Zipser Städte, an deren Spitze der Zipser
Graf stand, der von den Richtern der Städte gewählt wurde. Der Bund erhielt eine
Selbstverwaltung, die etwa derjenigen der königlichen Freistädte entsprach. Seit
1370 haben die 24 Städte des Bundes sowie 20 weitere Zipser Siedlungen ein
einheitliches Zipser Recht (Zipser Willkür) angewandt.
Der Bund der 24 Zipser Städte wurde 1412 aufgelöst, als König Sigismund von
Luxemburg aus finanziellen Gründen (Kreditaufnahme für den Krieg gegen Venedig)
13 dieser Städte sowie das Gebiet um die Burg Stará Ľubovňa (dt. Altlublau,
poln. Lubowla) an Polen verpfändete, das in ihre Selbstverwaltung allerdings
nicht eingriff. Nominell gehörten die verpfändeten Gebiete weiterhin zum
Königreich Ungarn und es wurde nur ihre wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung,
vor allem die Steuereinnahmen, verpfändet. Die verpfändeten Städte bildeten 1412
den Bund der 13 Zipser Städte und verzeichneten aufgrund ihrer Mittlerrolle (an
Polen verpfändete deutsche Städte in Ungarn mit slowakischen Untertanen) einen
wirtschaftlichen Aufschwung. Die restlichen 11 Städte, die 1412 den Bund der 11
Zipser Städte bildeten, konnten hingegen die traditionell privilegierte Stellung
der Städte in der Zips nicht halten und gerieten bereits 1465 in die
Abhängigkeit der Zipser Burg. Sie sind in der Folge auf das Niveau
bedeutungsloser Dörfer herabgesunken und haben großteils auch ihren deutschen
Charakter verloren.
Die Verpfändung der Zipser Städte sollte, wie damals üblich, nicht lange dauern,
es vergingen aber 360 Jahre, bis die Städte 1769 zurück an das von Haus
Österreich dominierte Königreich Ungarn kamen, ohne dabei die Pfandsumme
einzulösen. Die zurückgewonnenen Gebiete wurden ab 1778 formal als die Provinz
der 16 Zipser Städte organisiert. Die Selbstverwaltung der Zipser Städte wurde
erst 1876 aufgehoben, sie kamen zum Komitat Zips hinzu.
![]()
Inhaber Elke Rehder
Blumenstr. 19
22885 Barsbüttel
USt-IdNr. DE172804871
Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail: 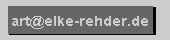
![]() zurück zum Antiquariat Liste Varia
zurück zum Antiquariat Liste Varia
|
|