Erzählungen von Franz Kafka - Künstlerbuch von Elke Rehder
Die Erzählungen "Die Brücke", "Gemeinschaft", "Der Kreisel", "Kleine Fabel", "Der Geier" und "Der Steuermann" mit 6 Farbholzschnitten von Elke Rehder. Broschur in dunkelgrauem Bugra-Bütten mit zusätzlichem Titelholzschnitt. 6 Zwischentitelblätter mit Original-Pinselzeichnungen. 24 Seiten, Format: 20 x 27 cm. 2002. Auflage: 80 nummerierte u. signierte Exemplare.
ARTIKEL-NR. P33 Preis 300,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.
Infos in englischer Sprache finden Sie in der PDF-Datei Franz Kafka Stories
Franz Kafka Erzählungen - Einband mit Holzschnitt
"KAFKA"
Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: »Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.« Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.
"Gemeinschaft" ist ein kleines parabelartiges Prosastück von Franz Kafka. Im Herbst 1920 löste sich Kafka von seiner Geliebten Milena Jesenska. Es entstanden in einem produktiven Schub eine Reihe kurzer Prosastücke. Dies sind Der Steuermann, Nachts, Gemeinschaft, Die Abweisung, Zur Frage der Gesetze, Die Truppenaushebung, Die Prüfung, Poseidon, Der Kreisel, Kleine Fabel und Der Geier. Kafka hat diese kleinen Werke nicht selbst veröffentlicht. Die Titel stammen weitgehend von Max Brod.
Kafka starb 1924 im niederösterreichischen Sanatorium
Kierling und hatte letztwillig verfügt, alle seine literarischen
Aufzeichnungen zu vernichten, und Max Brod als Nachlassverwalter
eingesetzt. Brod setzte sich über dessen letzten Willen hinweg, da er
glaubte, die angeordnete Vernichtung von Franz Kafkas Manuskripten
kulturell nicht verantworten zu können und diese weiter veröffentlichen
wollte. Dies führt bis heute zu Auseindersetzungen um das berühmte und
lukrative Erbe. Max Brod soll sich verpflichtet gefühlt haben, die
literarische Welt auf Leben und Denken Kafkas aufmerksam zu machen, den
er als den „größten Dichter unserer Zeit“, nämlich des 20. Jahrhunderts,
rühmte.
Bereits 1925 begann Max Brod mit der Veröffentlichung der Romanfragmente
Kafkas. In den Dreißigerjahren folgten eine sechsbändige Werkausgabe und
eine Biografie Kafkas. In zahlreichen Veröffentlichungen wehrte sich
Brod gegen eine von ihm als einseitig angesehene Interpretation der
Werke Kafkas, die zu der Kennzeichnung kafkaesk für bestimmte
Sachverhalte geführt hat. (Quelle: Wikipedia)
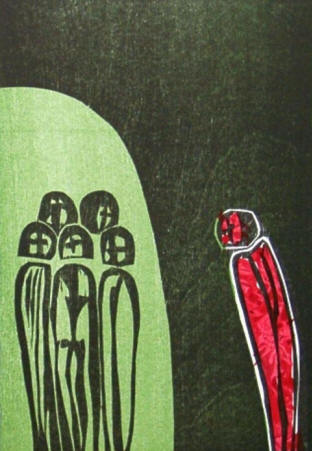
Franz Kafka Gemeinschaft - Holzschnitt von Elke Rehder
Gemeinschaft - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder
Kleine Fabel (A Little Fable)
»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie.
Kleine Fabel ist eine kurze fabelartige Geschichte über
eine verzweifelte Maus von Franz Kafka, die 1920 entstand. Sie wurde
postum von Max Brod herausgegeben, der ihr auch den Titel gab.
Die Maus ist ein wirklich bedauernswertes, unfreies, verängstigtes
Geschöpf. Fast nie ist die Welt so, wie sie sie haben möchte. Zwischen
zu weit und immer enger werdend gibt es nur ein schmales Zustandsfenster
der Behaglichkeit für sie, bezeichnenderweise der Anblick der in der
Ferne auftauchenden begrenzenden Mauern.
Sie läuft wie hypnotisiert der Falle entgegen, als gäbe es keinen
anderen Weg. Der Rat der Katze, doch die Richtung zu ändern, könnte an
sich der Rat eines Freundes sein, der einen Ausweg aus festgefahrenem
Denken zeigen möchte. Nur zu diesem Zeitpunkt und von der Katze
vorgebracht ist er zynisch und sinnlos. Man spricht daher von einer
„kafkaesken Situation“. Denn nicht die Falle ist die Gefahr, sondern die
sich unbemerkt heranschleichende Katze selbst. Die Falle stand einfach
nur da; hätte die Maus nicht die Entscheidungsmöglichkeit gehabt, ihr
nicht nahe zu kommen? Aber die Frage ist ohnehin müßig. Das Näherkommen
der Katze als die eigentliche Todesgefahr hat die Maus (und der Leser)
gar nicht bemerkt, also hatte sie auch keine Gelegenheit, sich davor zu
fürchten. Ansonsten ist die Maus ganz eingesponnen in ihre Ängste und
Zwänge. Ist es da nicht fast eine Erlösung, wenn die Katze diese
Existenz beendet?
Der Weg zwischen den enger werdenden Mauern auf die Falle zu könnte auch
allgemein den Lebensweg mit dem zwangsläufigen Ende durch den Tod
darstellen. Hier werden in wenigen Worten Etappen des menschlichen
Lebens signalisiert. Die schwierige Findung in der Jugend. Die
beengenden Pflichten des Erwachsenen. Da scheint der Spruch der Katze
fast wie eine Verlockung des vielfältig in seinem Normalleben
festgefahrenen Menschen in einen Aufbruch in Richtung einer
grundsätzlich neuen Situation, die allerdings in die Vernichtung führt.
Die Sorge wegen der Falle stellte die allgemeine Existenzsorge
einschließlich der Angst vor dem Tod dar. Sie gehen aber durch ein ganz
unerwartetes vorzeitiges Sterben völlig ins Leere. Die Maus befindet
sich aussichtslos zwischen verschiedenen Varianten des Todes, und zwar
nicht nur durch äußere Gefahr, sondern durch die eigene innere
Befindlichkeit.
Denkbar ist es aber auch, die Provokation der Fabel zu unterlaufen,
ihrer Aussage auszuweichen. Vielleicht geht es nicht um den Menschen an
sich, sondern eben um die „graue Maus“, die diesen Zwängen unterliegt,
was aber nicht zwangsläufig gelten muss. So könnte die kleine Fabel ja
auch eine Aufforderung sein, frühzeitig souverän das Leben anzugehen und
eben nicht zwangsläufig zwischen Mauern in die Falle zu laufen.
Wie in vielen Kafka-Erzählungen ist die Fehleinschätzung der Realität
und das Scheitern das Thema. Im Gegensatz zu diesen anderen Erzählungen
wie z.B. Der Bau, Forschungen eines Hundes, Der Dorfschullehrer, in
denen abschließend ein gewisser unbefriedigender Schwebezustand bleibt,
führt die vorliegende Geschichte abrupt in ein tödliches Ende. Und die
Furcht der Maus bekommt so – allerdings ohne kausalen Zusammenhang – im
Nachhinein ihre volle Berechtigung.
Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

Franz Kafka Kleine Fabel - Holzschnitt von Elke Rehder
Kleine Fabel - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder
Die Brücke (The Bridge)
Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich.
Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in
bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes
wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach.
Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in
den Karten noch nicht eingezeichnet. - So lag ich und wartete; ich mußte
warten. Ohne einzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören,
Brücke zu sein.
Einmal gegen Abend war es - war es der erste, war es der tausendste, ich
weiß nicht, - meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in
der Runde. Gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, da hörte
ich einen Mannesschritt! Zu mir, zu mir. - Strecke dich, Brücke, setze
dich in Stand, geländerloser Balken, halte den dir Anvertrauten. Die
Unsicherheit seines Schrittes gleiche unmerklich aus, schwankt er aber,
dann gib dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ins Land.
Er kam, mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich, dann hob
er mit ihr meine Rockschöße und ordnete sie auf mir. In mein buschiges
Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich wild
umherblickend, lange drin liegen. Dann aber - gerade träumte ich ihm
nach über Berg und Tal - sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den
Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Wer war es?
Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmörder? Ein Versucher?
Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. - Brücke dreht
sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon, ich
stürzte, und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den
zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich aus dem rasenden
Wasser angestarrt hatten.
Die Brücke ist ein Prosastück von Franz Kafka, das
1916/1917 entstand und postum von Max Brod veröffentlicht wurde. Es war
einer der ersten Texte, die in der Prager Alchimistengasse entstanden,
unabhängig von Kafkas Elternhaus. Zu dieser Zeit war der Künstler mit
Felice Bauer aus Berlin zum zweiten Mal verlobt.
Es war eine Brücke über einen Abgrund in einer einsamen Höhe. Diese
Brücke wartet auf den ersten Menschen, der sie betreten würde. Sie sieht
ihm mit Hinwendung, ja Fürsorge, entgegen. Dieser Mensch kommt nun
tatsächlich, springt mit beiden Beinen auf die Brücke und fügt ihr dabei
„wilde Schmerzen“ zu. Die Brücke will sich umdrehen, um diesen Menschen
genauer anzusehen. Dabei stürzt sie ab und landet „zerrissen und
aufgespießt“ im Bach in der Tiefe.
Ein Ich-Erzähler schildert den Ablauf in der Vergangenheitsform, ohne
Erläuterung oder eigenes Erstaunen über den Auftritt einer menschlichen
Brücke, einem Mischwesen also zwischen Bauwerk und Mensch. Die
Ausdrucksweise ist – entgegen dem sonst meist unberührt-sachlichen
Duktus Kafkas – hier eher emotional, fast pathetisch.
Die Brücke beschreibt sich selbst mit menschlichen Bestandteilen –
„Fußspitzen, Hände, Schöße des Rockes, Haar“. Auch die Sicht auf die
Umwelt ist menschlich. Dem Wesen, das die Brücke als erstes betreten
wird, ist sie vorab zugetan, will es schützen und bewahren; obwohl ihr
die Aufgabe, nämlich Brücke zu sein, schwerfällt. Die Begriffe „steif
und kalt, musste warten, Gedanken gingen in einem Wirrwarr“ bringen das
zum Ausdruck. Die Anteilnahme am Wanderer wird schlecht belohnt. Der
springt brutal auf die Brücke; warum sollte er auch nicht, er weiß
nichts von deren menschlichen Fühlen.
Die Brücke aber fragt sich nach dem Wesen des Wanderers. Zwischen „Kind“
und „Vernichter“ sind mehrere Varianten denkbar. Um hier eine Antwort zu
bekommen, dreht sich die Brücke um. Sie kommentiert das selbst wie
erstaunt: „Brücke dreht sich um!“ Sie stürzt hinab, aber die Zerstörung
geschieht nicht durch den Wanderer, sondern durch ihre nicht
„brückengemäße“ Erkenntnissuche.
Was mit dem Wanderer geschieht, erfährt man nicht, er dürfte wohl mit
der zersprungenen Brücke in den Abgrund fallen. Die Brücke hat mit ihrem
Umdrehen keine Erkenntnis über den Wanderer gewonnen, sondern den
eigenen Tod gefunden.
Der letzte Satz lässt schaudern. Die Brücke wird „aufgespießt von den
zugespitzten Kieseln, die mich so friedlich immer angestarrt hatten aus
dem rasenden Wasser“. In den Zeiten des langen, bedrückenden Wartens
hatte also die Brücke im Anblick der Kiesel im Bach einen gewissen
Frieden gefunden und gerade von ihnen wird sie zerstört.
Das vorliegende Prosastück ist in der Literatur relativ
wenig behandelt und interpretiert worden. Es sind hier Bezüge zu anderen
Kafka–Erzählungen erkennbar, in denen ganz selbstverständlich Mischwesen
auftreten – dort allerdings zwischen Mensch und Tier.
Zieht man Rückschlüsse aus der Geschichte auf ihren Schöpfer, ist klar,
dass er unglücklich gewesen sein muss. Er fühlt sich eingespannt in eine
ungeliebte Situation. Er versucht seiner Pflicht gerecht zu werden, ja
die Pflicht zur Neigung werden zu lassen. Er fühlt sich von Menschen
oder Dingen, denen er sich positiv zuzuwenden versucht, vernichtet. Dass
hier die bekannten Bedrängnisse in Kafkas Leben – seine Arbeit als
Jurist, sein Verhältnis zum Vater oder zur Verlobten – der Hintergrund
sind, ist sehr wahrscheinlich.
Quelle: Wikipedia Stand 02.2014
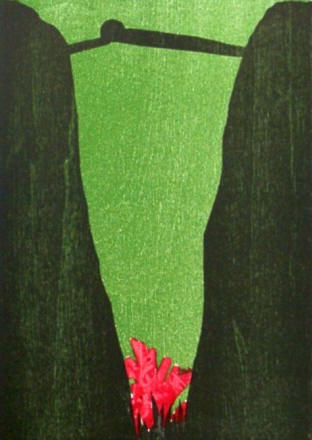
Franz Kafka Die Brücke - Holzschnitt von Elke Rehder
Die Brücke - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder
Der Kreisel (The Top)
Ein Philosoph trieb sich immer dort herum, wo Kinder spielten. Und sah er einen Jungen, der einen Kreisel hatte, so lauerte er schon. Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph, um ihn zu fangen. Dass die Kinder lärmten und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten, kümmerte ihn nicht, hatte er den Kreisel, solange er sich noch drehte, gefangen, war er glücklich, aber nur einen Augenblick, dann warf er ihn zu Boden und ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also zum Beispiel auch eines sich drehenden Kreisels genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen. Darum beschäftigte er sich nicht mit den großen Problemen, das schien ihm unökonomisch, war die kleinste Kleinigkeit wirklich erkannt, dann war alles erkannt, deshalb beschäftigte er sich nur mit dem sich drehenden Kreisel. Und immer, wenn die Vorbereitungen zum Drehen des Kreisels gemacht wurden, hatte er Hoffnung, nun werde es gelingen, und drehte sich der Kreisel, wurde ihm im atemlosen Laufen nach ihm die Hoffnung zur Gewissheit, hielt er aber dann das dumme Holzstück in der Hand, wurde ihm übel und das Geschrei der Kinder, das er bisher nicht gehört hatte und das ihm jetzt plötzlich in die Ohren fuhr, jagte ihn fort, er taumelte wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche.
Der Kreisel ist eine 1920 entstandene, kurze
parabelartige Geschichte über einen unermüdlichen Philosophen von Franz
Kafka. Max Brod hat sie postum betitelt und herausgegeben.
Eine Geschichte ist es eigentlich nicht, was hier erzählt wird:
Geschichten entwerfen einen einzelnen „Fall“, hier wird berichtet, was
„immer“ geschieht – und das gleich zweimal hintereinander, wenn man von
dem etwas gleich langen Mittelstück (von „Er glaubte nämlich“ bis „dem
sich drehenden Kreisel“) absieht. Diese Anlage des Textes erinnert an
Auf der Galerie, wo ebenfalls zweimal derselbe Vorgang aus
unterschiedlicher Sichtweise geschildert wird, ohne dass diesem der
Status des Faktischen zukäme. Hier wie dort stellt sich die Einheit des
Textes nicht über eine erzählte Handlung her, sondern im
Aufeinanderprallen der beiden gegensätzlichen Beschreibungen.
Das Programm des Philosophen ist, vom Standpunkt der klassischen Physik
aus betrachtet, deswegen zum Scheitern verurteilt, weil ihn gerade die
„Ökonomie“ seiner Herangehensweise übersehen lässt, dass er, indem er in
das Spiel der Kinder eingreift, selbst Teil des Systems wird, das er
begreifen will. Es geht ihm wie den Physikern, denen es nach Werner
Heisenbergs (1901-1976) Unbestimmtheitstheorem von 1927 (der so
genannten „Unschärferelation“) nicht gelingen kann, gleichzeitig Impuls
(„Drehung“) und stationären Zustand („dummes Holzstück“) von kleinsten
Teilchen wie Atomen oder Elektronen zu bestimmen, weil der Messvorgang
(das „Fangen“ des Kreisels) die Einheit aus beidem zerstört.
Diese äußere Problematik spiegelt jedoch einen verdrängten inneren
Konflikt. Nicht ohne Grund nämlich scheint sich der Philosoph
ausgerechnet ein „Spielzeug“ für seine Forschung auserkoren zu haben. So
„lauert“ er zwar den Kindern im Hinblick auf ein mögliches Kreiselspiel
auf, verliert sie dann aber völlig aus Augen und Ohren, bis sie dann,
nach dem Fehlschlagen des Experiments, plötzlich überpräsent sind und zu
der Peitsche werden, die den Philosophen selbst zu einem Kreisel werden
lässt – einem Kreisel, allerdings, der nicht präzise rotiert, sondern
„taumelt“. Die Ausblendung der Kinder aus seinem Wahrnehmungsbereich
katapultiert diesen Weisen in einen Zwischenzustand, wo weder die Rede
vom „Spielzeug“ noch die vom „dummen Holzstück“ gilt. Die „großen
Probleme“ wären hier tatsächlich gelöst, aber die Lösung ist das
Problem.
Quelle: Wikipedia Stand 02.2014
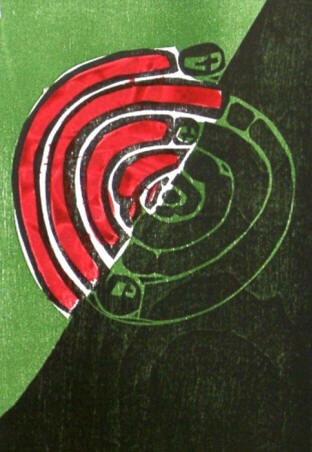
Franz Kafka Der Kreisel - Holzschnitt von Elke Rehder
Der Kreisel - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder
Der Steuermann (The Helmsman)
»Bin ich nicht Steuermann?« rief ich. »du?« fragte ein dunkler hoch gewachsener Mann und strich sich mit der Hand über die Augen, als verscheuche er einen Traum. Ich war am Steuer gestanden in der dunklen Nacht, die schwachbrennende Laterne über meinem Kopf, und nun war dieser Mann gekommen und wollte mich beiseiteschieben. Und da ich nicht wich, setzte er mir den Fuß auf die Brust und trat mich langsam nieder, während ich noch immer an den Stäben des Steuerrades hing und beim Niederfallen es ganz herumriss. Da aber fasste es der Mann, brachte es in Ordnung, mich aber stieß er weg. Doch ich besann mich bald, lief zu der Luke, die in den Mannschaftsraum führte und rief: »Mannschaft! Kameraden! Kommt schnell! Ein Fremder hat mich vom Steuer vertrieben!« Langsam kamen sie, stiegen auf aus der Schiffstreppe, schwankende müde mächtige Gestalten. »Bin ich der Steuermann?« fragte ich. Sie nickten, aber Blicke hatten sie nur für den Fremden, im Halbkreis standen sie um ihn herum und, als er befehlend sagte: »Stört mich nicht«, sammelten sie sich, nickten mir zu und zogen wieder die Schiffstreppe hinab. Was ist das für Volk! Denken sie auch oder schlurfen sie nur sinnlos über die Erde?
Der Steuermann ist ein kleines Prosastück von Franz Kafka aus dem
Jahr 1920, in der ein Ich-Erzähler als Steuermann eines Schiffes von
einem Eindringling gewaltsam verdrängt wird, ohne dass die Mannschaft
des Schiffs ihm bei der Wiedererlangung seiner alten Position hilft.
Der Erzähler fragt zu Beginn der Geschichte, ob er nicht Steuermann sei.
Er hat zuvor in dunkler Nacht am Steuerrad gestanden, als ein „Fremder“
plötzlich aufgetaucht ist. Dieser drängt den Erzähler zur Seite, der im
Fallen das Steuerrad herumreißt, aber der andere korrigiert dieses
Fehlsteuern und übernimmt das Steuer. Der Erzähler ruft nach der
Mannschaft im Schiffsrumpf. Sie kommt herauf, hilft ihm aber nicht, ist
vielmehr fasziniert von dem Eindringling und zieht sich wieder in das
Innere des Schiffs zurück.
Man kann dieses Prosastück als Gleichnis über einen politischen Führer
sehen, dem seine Anhängerschaft unter dem Einfluss eines neuen
charismatischeren Konkurrenten entgleitet und der sich über den
Opportunismus des Volkes ärgert, das sich für Fragen der Legitimität
nicht zu interessieren scheint und das, obwohl durchaus „mächtig“, einen
Gewaltanwender gewähren lässt.
Die Sitte, den Staat mit einem Schiff zu vergleichen, ist sehr alt. Bei
der Rede vom Staat als Schiff und den Regierenden als „Steuermännern“
handelt es sich um einen Topos, der sich in Begriffen wie „Gouverneur“
(wörtlich: „Steuermann“) verfestigt hat. Sieht man im Schiff „das
Staatsschiff“, dann gehören (zumindest in einer Demokratie) auch die
Regierenden, die „Gouverneure“, eigentlich zum „Volk“, dem Demos, dem
sie lediglich dienen. Indem es der Mannschaft in Der Steuermann
gleichgültig zu sein scheint, wer das Schiff steuert und ob der
vorgesehene Kurs beibehalten wird, zeigen sie, dass sie, obwohl sie der
Erzähler ausdrücklich als „mächtig“ charakterisiert, nicht bereit sind,
sich gegen einen Putschisten und für die Demokratie einzusetzen.
Der Erzähler ist resigniert und sieht demnach in seiner Mannschaft zu
Recht nur ein sinnlos dahin schlurfendes Volk. Indem er die Männer aber
in der dritten Person („sie“) als „Volk“ bezeichnet, zeigt er, dass er
sich selbst zu ebendiesem „Volk“ nicht zugehörig fühlt. Das trifft in
dem Sinne zu, dass ein Steuermann immer einer Elite angehört, die durch
ihre Position vom einfachen Volk getrennt ist. Andererseits spricht der
ehemalige Steuermann die Männer der Mannschaft, bevor sie ihn im Stich
lassen, ausdrücklich mit dem Wort „Kameraden“ an. Tatsächlich „sitzen
alle in einem Boot“, und es läge von daher nur nahe, wenn alle (trotz
aller möglichen gegenseitigen Ressentiments) zusammenhielten,
insbesondere gegen einen Eindringling, der das Schiff nach Art von
Piraten geentert hat und dessen Absichten unbekannt sind.
Das Argument des „Sitzens in einem Boot“ muss nicht unbedingt mit
demokratischer Tendenz benutzt werden: Es impliziert, dass der
Steuermann und seine Mannschaft (sowie die Passagiere, von denen im
Kafka-Text aber nicht die Rede ist) derselben Gefahr ausgesetzt sind.
Sie bilden eine Notgemeinschaft, deren Mitglieder aufeinander angewiesen
und deshalb schon aus Eigennutz zu solidarischem Handeln verpflichtet
sind. Das Wohlergehen des einzelnen hängt von der sicheren Fahrt des
Schiffes ab und damit auch vom Wohlergehen aller übrigen Mitreisenden.
Dieser Gedanke ist schon der Antike vertraut; am Beispiel des
Steuermanns, der selbst zu den Mitreisenden gehört und deshalb auch an
ihrem Nutzen teilhat, erläutert Aristoteles, inwiefern Herrschaft sowohl
den Regierten als auch den Regierenden nützt. Der Ich-Erzähler erwartet
offenbar, dass seine Mannschaft genau das einsieht, und verzweifelt
deshalb über ihre „Gedankenlosigkeit“.
Der Erzähler scheint aber blind gegenüber seiner eigenen Rolle bei der
Übernahme der Macht durch den „Fremden“ zu sein. Die Art, wie die
Mannschaft zunächst mitten in der Nacht klaglos (wenn auch nicht in dem
vom Steuermann gewünschten Tempo) seiner Anweisung folgt, zeigt, dass
sie das Gehorchen ohne Nachdenken gewohnt ist, woran der Steuermann wohl
nicht ganz schuldlos ist. Diese Gewohnheit setzen die Männer auch dem
„Fremden“ gegenüber fort, den sie zudem wohl für attraktiver halten als
ihren alten Steuermann.
Der Fremde in Der Steuermann ist eine der
vielen von rabiater Stärke gekennzeichneten Vater-Figuren im Werk Franz Kafkas.
Wie in seinem 1919 verfassten Brief an den Vater deutlich wird, empfand Kafka
seinen Vater als eine Instanz, die immer wieder seinen Lebensweg negativ
beeinflusste. Den Weg durchs eigene Leben könnte man mit einer Fahrt auf dem
„Lebensschiff“ vergleichen, und das erzählende Ich, der Steuermann, der
selbstbewusst „Kurs zu halten versucht“, stünde für Kafka selbst. Sobald in der
Geschichte der Fremde ins Spiel kommt, weckt er, noch bevor er etwas gesagt oder
getan hat, Zweifel im Ich, ob dieses überhaupt sein Lebensschiff steuern könne.
Dass das Ich scheinbar unmotiviert die Frage stellt: „Bin ich nicht
Steuermann?“, mit der Kafkas Geschichte beginnt, lässt sich mit der Unsicherheit
erklären, die das bloße Erscheinen der „dunklen“ Vaterfigur auslöst.
Der Vater als psychische Instanz ist offenbar aus dem Bewusstsein des
Sohnes verdrängt worden und erscheint deshalb, wie auch immer seine plötzliche
Anwesenheit zu erklären ist (in der Geschichte wird sie nicht erklärt), bei
seinem Auftauchen als „Fremder“. Sein Auftritt ist äußerst wirkungsvoll: Nicht
allein seine körperliche Stärke, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit
der er den Anspruch des Sohnes, Steuermann zu sein, wie „einen Traum“
„verscheucht“, schwächen das Ich so stark, dass es tatsächlich
„steuerungsunfähig“ wird und sich der Vaterfigur geschlagen geben muss.
Die Mannschaft steht in dieser Interpretation für Kafkas Familie. Von
dieser fühlte sich Kafka um 1920 laut des Briefs an den Vater alleingelassen.
Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

Franz Kafka Der Steuermann - Holzschnitt von Elke Rehder
Der Steuermann - gemalter Zwischentitel von Elke
Rehder
Der Geier (The Vulture)
Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. »Ich bin ja wehrlos«, sagte ich, »er kam und fing zu hacken an, da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte, auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind sie schon fast zerrissen.« »Daß Sie sich so quälen lassen«, sagte der Herr, »ein Schuß und der Geier ist erledigt.« »Ist das so?« fragte ich, »und wollen Sie das besorgen?« »Gern«, sagte der Herr, »ich muß nur nach Hause gehn und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten?« »Das weiß ich nicht«, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz, dann sagte ich: »Bitte, versuchen Sie es für jeden Fall.« »Gut«, sagte der Herr, »ich werde mich beeilen.« Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, daß er alles verstanden hatte, er flog auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar ertrank.
Der Geier ist ein kleines parabelartiges Prosastück von Franz Kafka aus dem Jahr 1920. Ein Geier zerfleischt die Füße eines Menschen, ohne dass diesem geholfen wird. Schließlich mündet es in ein Blutgemetzel.
Ein Ich-Erzähler schildert, wie ihm ein Geier, der schon seine Stiefel und Strümpfe aufgerissen hat, in die Füße hackt. Ein Herr kommt vorbei und fragt, warum er den Geier duldet. Der Erzähler bezeichnet sich als wehrlos. Er habe die Füße geopfert, um zu verhindern, dass das Tier ihm sonst ins Gesicht gesprungen wäre. Der Herr wundert sich über diese Quälerei und meint, dass der Geier durch einen Schuss erledigt wäre. Der Erzähler bittet den Herrn, das für ihn zu tun. Allerdings muss erst das Gewehr geholt werden. Der Geier hat die Unterhaltung verfolgt und offensichtlich verstanden. Mit großem Schwung stößt er seinen Schnabel durch den Mund des Erzählers. In den entstehenden Unmengen von Blut ertrinkt der Geier „unrettbar“, während der Erzähler sich befreit fühlt.
Das Prosastück, das vielfach direkte Rede enthält, ist nicht in sich
gegliedert. Inhaltlich ist eine Dreiteilung zu erkennen.
- Einleitende Darstellung der Situation mit dem Geier
- Gespräch mit dem Herrn als längster Part des Stückes
- Reaktion und Tod des Geiers
Die Erzählperspektive ist mehrschichtig. Da ist ein Ich-Erzähler, der am
Schluss vom Tod des Geiers spricht. Dass er selbst auch den Tod findet,
scheint sich angesichts der Blutströme zunächst aufzudrängen, aber das
wird nicht explizit gesagt. Außerdem, wie könnte er uns dann die
Geschichte präsentieren? Spricht er aus dem Totenreich oder hat er im
Moment der größten Gefahr in einer Art Katharsis den Tod überwunden?
Der Erzähler wird von einem großen Aasfresser attackiert. Der
Erzähler bezeichnet dies als die Arbeit des Geiers, also etwas fast
Legitimiertes, Zwangsläufiges. Wie der Tausch des Gesichtes gegen die
angebotenen Füße zustande kam, wird nicht näher erläutert. Da hat es
offensichtlich eine Verständigung gegeben, zumindest in Gesten. Das
Gespräch mit dem Herren wirkt wunderlich. Aus der Situation heraus wäre
ein sofortiges Eingreifen bzw. das Auffordern zum sofortigen Eingreifen
angebracht gewesen und nicht dieses umständliche Reden, das eher eine
Rechtfertigung ist, warum sich der Erzähler eben nicht konsequent wehrt.
Das Tier dagegen ist mächtig in seiner ruhigen körperlichen Kraft und
zielstrebigen Art im Gegensatz zum zögerlichen Erzähler, der den Geier
fast zu bewundern scheint. Dem Gespräch der beiden Männer hat der Geier
ruhig zugehört, eigentlich wie ein dritter stiller Gesprächsteilnehmer,
um dann in furioser Weise sein Vernichtungswerk zu verrichten.
Die kleine Geschichte baut sich zunächst fast ungelenk auf – vor allem
durch die direkten Reden des Mittelteils. Die beiden letzten Sätze aber
erscheinen wie eine dicht gedrängte Abfolge bis zum Höhepunkt, in dem
sich alles bündelt:
- die Absicht des Geiers
- der schreckliche Schnabelhieb
- das Befreiungsgefühl des zurückfallenden Erzählers
- die Blutströme, in denen der Geier ertrinkt
Es erscheint hier ein Grundmuster Kafkas, nämlich die Darstellung
eines quälenden Zustandes, der durch Untergang, Vernichtung, Tod beendet
wird, wobei dieses Ende als Befreiung empfunden wird. „Der Tod ist der
Ort der befreienden Auslöschung des letzten Gedächtnisses“ formuliert
hierzu Peter-André Alt. Dieses Muster erkennt man auch in den kleinen
Prosastücken Das Stadtwappen oder Poseidon. Die Brücke ist insofern
ähnlich, als auch dort am Ende eine drastisch berührende, körperliche
Gewalteinwirkung und Verletzung geschildert wird.
Ein ganz paralleler Ablauf erscheint in der Geschichte Das Urteil. Ein
junger Mann wird von seinem Vater gescholten und verspottet (also
gequält) und zum Tod durch Ertrinken verurteilt. Der Sohn vollzieht das
Urteil, wobei der Tod nicht explizit gezeigt wird. Abschließend
erscheint das Bild eines vitalen Verkehrs. Auch in Die Verwandlung sind
ähnliche Momente vorhanden. Besonders diese beiden letztgenannten Stücke
werden interpretiert als Kafkas Auseinandersetzung mit seinem
polternden, verständnislosen Vater. So liegt der Schluss nahe, dass auch
im Geier die Konstellation eines zaudernden unterlegenen Sohnes und
eines vitalen, rücksichtslosen Vaters symbolisiert wird.
Quelle: Wikipedia Stand 02.2014
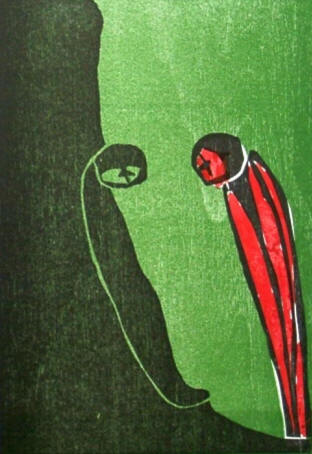
Franz Kafka Der Geier - Holzschnitt von Elke Rehder
Der Geier - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder
![]()
Inhaber Elke Rehder
Blumenstr. 19
22885 Barsbüttel
USt-IdNr. DE172804871
Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail: 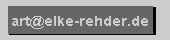
Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.
|
|