Friedrich Hölderlin An Herkules - Radierungen von Elke Rehder
![]() zurück
zur Friedrich Hölderlin
zurück
zur Friedrich Hölderlin
Mappe mit 4 nummerierten, signierten und betitelten Radierungen von Elke Rehder und einem handgeschöpften Papierobjekt auf dem Titelblatt. Vorwort von Günther Nicolin. Handeinband (Christian Zwang, Hamburg) in dunkelrotem Leinen. 6 Seiten Text, Format: 39 x 55 cm. 1994. Auflage: 40 nummerierte u. signierte Exemplare.
ARTIKEL-NR. P29 Preis 400,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.
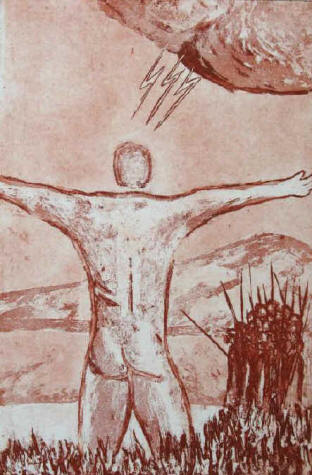
Friedrich Hölderlin: An Herkules - wie Kronions Blitze,
aus der Jugend Wolke los. Radierung von Elke Rehder zum Mappenwerk An Herkules
In der Kindheit Schlaf begraben
Lag ich, wie das Erz im Schacht;
Dank, mein Herkules! den Knaben
Hast zum Manne du gemacht,
Reif bin ich zum Königssitze,
Und mir brechen stark und groß
Taten, wie Kronions Blitze,
Aus der Jugend Wolke los.
Wie der Adler seine Jungen,
Wenn der Funk im Auge glimmt,
Auf die kühnen Wanderungen
In den frohen Äther nimmt,
Nimmst du aus der Kinderwiege,
Von der Mutter Tisch und Haus
In die Flamme deiner Kriege,
Hoher Halbgott, mich hinaus.
Wähntest du, dein Kämpferwagen
Rolle mir umsonst ins Ohr?
Jede Last, die du getragen,
Hub die Seele mir empor,
Zwar der Schüler mußte zahlen;
Schmerzlich brannten, stolzes Licht,
Mir im Busen deine Strahlen,
Aber sie verzehrten nicht.
Wenn für deines Schicksals Wogen
Hohe Götterkräfte dich,
Kühner Schwimmer! auferzogen,
Was erzog dem Siege mich?
Was berief den Vaterlosen,
Der in dunkler Halle saß,
Zu dem Göttlichen und Großen,
Daß er kühn an dir sich maß?
Was ergriff und zog vom Schwarme
Der Gespielen mich hervor?
Was bewog des Bäumchens Arme
Nach des Äthers Tag empor?
Freundlich nahm des jungen Lebens
Keines Gärtners Hand sich an,
Aber kraft des eignen Strebens
Blickt' und wuchs ich himmelan.
Sohn Kronions! an die Seite
Tret ich nun errötend dir,
Der Olymp ist deine Beute;
Komm und teile sie mit mir!
Sterblich bin ich zwar geboren,
Dennoch hat Unsterblichkeit
Meine Seele sich geschworen,
Und sie hält, was sie gebeut.
Herkules – in mythologischer Sicht gilt er als der Held, der aus eigener
Kraft sein Leben gestaltet und dem es gelingt, göttliche Unsterblichkeit zu
erringen.
Für den jungen Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) ist Herkules der
mächtige Erwecker aus verträumter Kindheit und führerloser Jugend. An der
Seite des Halbgotts gewinnt er das Selbstbewusstsein schöpferischer
Existenz.
In den Rahmen der Biographie des Dichters stellt Elke Rehder ihre graphische
Deutung des Gedichts „An Herkules“: zunächst der jugendlich strebende
Hölderlin im Schattenriss, am Ende der vereinsamt umnachtete Turmbewohner in
Tübingen. Zweifach der Blick auf das Gedicht: das heldische Leben im
Aufbruch zu ruhmreicher Tat – das emporstrebende Leben „nach des Äthers
Tag“.
Anmerkung von Elke Rehder zu den Radierungen
Meine Radierungen sind keine Illustrationen. Ich habe das Gedicht An Herkules nicht illustriert. Die Kunst gibt mir die Freiheit, meine eigenen Gedanken und Empfindungen zu Hölderlins Strophen bildhaft zu machen.
In der nachfolgenden Abbildung trägt Herkules die Last. Der Vulkankegel im Hintergrund bringt eine Verbindung zu Hölderlins Empedokles. Der Tod des Philosophen Empedokles in der feuerroten Glut des Ätna wurde von mir im Jahre 2001 mit handgeschöpften Papierobjekten in Kombination mit Radierungen behandelt (siehe meine Kassette zu drei Gedichten von Friedrich Hölderlin).
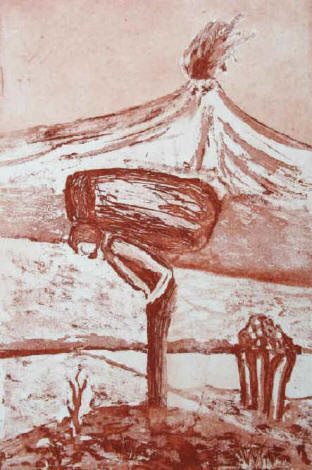
Jede Last, die du getragen,
Hub die Seele mir empor, Radierung von Elke Rehder zum Mappenwerk An Herkules
Friedrich Hölderlin hat eine enge Verbindung zum Neckar, einem 362 km langen Nebenfluss des Rheins. Friedrich Hölderlin verbrachte seine Kindheit und Jugend in Nürtingen an den Ufern des Neckars, wohin er auch später immer wieder gerne zurückkehrte. Nürtingen ist heute die drittgrößte Stadt des Landkreises Esslingen. Das Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen ist nach dem Dichter benannt.
Die nebenstehende Radierung zeigt den jungen Hölderlin, in dessen Kopf die Gedanken als Quelle sprudeln und fließen. Ähnlich wie das Wasser im Neckar kontinuierlich dahinfließt, fließt auch das Leben dahin. Hölderlin hat in diesem Bilde die Hälfte des Lebens noch nicht erreicht. Noch ist der Adler in seinem Kopf, der mit weit ausgebreiteten Schwingen das Weltgeschehen aus der Höhe des Olymps betrachtet. Das griechische Wort "Olymp" kann auch mit "Himmel" übersetzt werden. In der griechischen Mythologie ist der Olymp der Berg der Götter. Hölderlin bleibt der griechischen Mythologie sein Leben lang verbunden.
In Hölderlins "Hymnische Entwürfe" wird das Symbol des Adlers deutlich:
Der Adler
Mein Vater ist gewandert, auf dem Gotthard,
Da wo die Flüsse, hinab,
Wohl nach Hetruria seitwärts,
Und des geraden Weges
Auch über den Schnee,
Zu dem Olympos und Hämos
Wo den Schatten der Athos wirft,
Nach Höhlen in Lemnos ...
Auch in Hölderlins Gedicht Patmos taucht das symbolische Bild des Adlers auf und der Dichter selbst scheint sich mit dem Adler zu identifizieren
Patmos
Dem Landgrafen von Homburg
Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Im Finstern wohnen
Die Adler und furchtlos gehn
Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg
Auf leichtgebaueten Brücken.
Drum, da gehäuft sind rings
Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten
Nah wohnen, ermattend auf
Getrenntesten Bergen,
So gib unschuldig Wasser,
O Fittiche gib uns, treuesten Sinns
Hinüberzugehn und wiederzukehren.
In Hölderlins Gedicht An den Aether findet man den Adler in der folgenden Strophe:
Möcht' ich wandern und rufen von da dem eilenden Adler,
Daß er, wie einst in die Arme des Zeus den seligen Knaben,
Aus der Gefangenschaft in des Aethers Halle mich trage.

Wie der Adler seine Jungen,
Wenn der Funk im Auge glimmt,
Auf die kühnen Wanderungen
In den frohen Äther nimmt
Radierung von Elke Rehder
Der Hölderlinturm zu Tübingen wurde im späten 19. Jahrhundert nach dem Dichter Friedrich Hölderlin benannt, der dort vom 3. Mai 1807 bis zu seinem Tod im Jahr 1843 lebte. Das Gebäude ist eine der bekanntesten Gedenkstätten Tübingens.
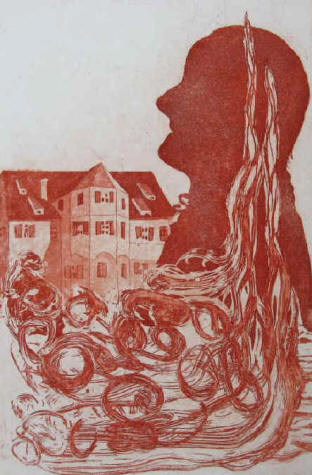
Portrait des alten Friedrich Hölderlin
im Hölderlinturm
am Neckar
Radierung von Elke Rehder
Die Geschichte des Hölderlinturms lässt sich bis ins 13. Jahrhundert
zurückverfolgen. Der Sockel des Turms war Teil der mittelalterlichen
Stadtmauer entlang des nördlichen Neckarufers. Die Existenz eines
unmittelbar an den Turmsockel angrenzenden Hauses ist seit dem frühen 17.
Jahrhundert belegt. Mit diesem unter einem Dach verbunden wurde im späten
18. Jahrhundert ein auf den Sockel aufgesetztes achteckiges Stockwerk.
Im Jahr 1807 wurde das Gebäude vom Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer
erworben. Dieser nahm dort noch im gleichen Jahr den als unheilbar krank aus
dem Autenrieth’schen Klinikum entlassenen Hölderlin, dessen Hyperion er
bewunderte, auf. Der Dichter bewohnte 36 Jahre lang im ersten Stock des
Turmes ein bescheiden eingerichtetes Zimmer.
Während der Turmzeit schrieb Hölderlin weiterhin – meist unter dem Pseudonym
Scardanelli – und empfing auch Besucher, wie beispielsweise die Dichter und
damaligen Studenten am Tübinger Stift Wilhelm Waiblinger und Eduard Mörike.
Hermann Hesse beschreibt 1914 in seiner Erzählung Im Presselschen Gartenhaus
einen Besuch der Beiden bei dem kranken Hölderlin im Turm.
Zimmer ließ das zweistöckige Gebäude bis 1828 mehrmals ausbauen. Er starb
1838, seine Tochter Charlotte kümmerte sich fortan um den kranken Hölderlin.
Im Jahr 1874 erwarb der Schuhmachermeister Carl Friedrich Eberhardt das
Haus, ließ es wiederum erweitern und richtete dort eine Badeanstalt ein. Am
14. Dezember des folgenden Jahres brannte der Turm bis auf das Erdgeschoss
ab. Bald wurden auf den Grundmauern ein neuer, runder Turm mit spitzerem
Dach und ein größeres angrenzendes Haus errichtet. In den Bauplänen findet
sich der Name „Hölderlin’s Turm“.
Die Stadt Tübingen erwarb im Jahr 1921 das Haus mit Unterstützung der
„Vereinigung zur Erhaltung und Erwerbung des Hölderlinturms“. Im Jahr 1984
wurde im Zuge einer Renovierung das Innere des Hauses der Raumaufteilung zu
Hölderlins Zeit angenähert.
Heute befindet sich hier das Hölderlin-Museum mit einer Dauerausstellung,
Sonderausstellungen und einer Präsenzbibliothek. Der Hölderlinturm wird im
Auftrag der Stadt Tübingen von der 1943 gegründeten Hölderlin-Gesellschaft,
die ihren Sitz in dem Haus hat, verwaltet.
(Quelle:Wikipedia)
![]()
Inhaber Elke Rehder
Blumenstr. 19
22885 Barsbüttel
USt-IdNr. DE172804871
Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail: 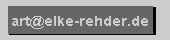
Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.
|
|