Friedrich Hölderlin Gedichte - Empedokles, Lebenslauf, Hälfte des Lebens
![]() zurück
zur Friedrich Hölderlin
zurück
zur Friedrich Hölderlin
Kassette mit 3 Farbradierungen, 3 farbigen handgeschöpften Papierobjekten mit Radierung und einer zusätzlichen Radierung auf dem Kassettendeckel. 5 Seiten Text. Format: 38 x 49 cm. Barsbüttel, Elke Rehder Presse, 2001. Auflage: 40 nummerierte und von der Künstlerin Elke Rehder signierte Exemplare.
ARTIKEL-NR. P26 Preis 600,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen. Radierung mit Papierobjekt zu "Hälfte des Lebens" von Friedrich Hölderlin
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
"Hälfte des Lebens" ist eines der berühmtesten Gedichte von Friedrich Hölderlin. Es erschien zuerst im Jahr 1804 in Friedrich Wilmans Taschenbuch für das Jahr 1805. Die Strophen weisen 42, bzw. 41 Silben auf, d. h. das Gedicht ist symmetrisch aufgebaut, mit dem Bruch genau in der Mitte. Die verwendeten Symbole: Birnbaum – Rosen – Wasser – Mauern – klirrende Fahnen könnten in ihrer Abfolge die Form einer Parabel andeuten, deren Scheitelpunkt in der Mitte des Gedichtes liegt. Die Zäsur zwischen den beiden Strophen, auf die so deutlich hingewiesen wird, ist nach Meinung einiger Autoren für Hölderlin ein Symbol des Erhabenen. Die Verklammerung zwischen den beiden Strophen ergibt sich aus Wasser und den darauf folgenden Weh-Fragen, schließlich endend mit Winde, dem Aushauchen des Lebens.
Hölderlin sandte die von ihm selbst als „Nachtgesänge“ bezeichneten Gedichte
(Chiron, Thränen, An die Hoffnung, Vulkan, Blödigkeit, Ganymed, Hälfte des
Lebens, Lebensalter, Der Winkel von Hahrdt) Ende 1803/Anfang 1804 aus Nürtingen
an den Verleger Friedrich Wilmans. Textgenetisch sind in dem Gedicht „Hälfte des
Lebens“ 11 Segmente zusammengefügt, die in anderen Zusammenhängen entstanden
sind. Erschienen sind die Gedichte Ende August 1804 im Taschenbuch für das Jahr
1805.
Selbst Verehrer Hölderlins konnten dieses Gedicht nicht einordnen. Christoph
Theodor Schwab und Ludwig Uhland, die 1826 einen ersten Hölderlin-Gedichtband
herausgaben, übergingen die Nachtgesänge, also auch Hälfte des Lebens, weil sie
sie für Produkte der Geisteskrankheit hielten. Das Gedicht erschien erst wieder
in der von Schwab 1846 besorgten Hölderlin-Gesamtausgabe, allerdings wurde in
dieser Version „Birnen“ durch „Blumen“ ersetzt; diese Version wird auch in der
Werkausgabe von 1906 in der Rubrik „Aus der Zeit des Irrsinns“ präsentiert. Das
Gedicht wurde vielfach vertont und in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Der Titel des Gedichts ist auch der Titel des DEFA-Spielfilms „Hälfte des Lebens“ von Herrmann Zschoche aus dem Jahre 1984, der Hölderlins Lebensjahre zwischen 1796-1806 darstellt. (Angaben nach Quelle Wikipedia)
Meine Gefühle für die "Hälfte des Lebens" – ein "memento mori" – habe ich in eine kombinierte Arbeit aus Papierobjekt mit Radierung hineingelegt. Das Fähnlein steht weiß und steif als Symbol für den Winter und gleichzeitig im übertragenen Sinne für die letzte Lebenshälfte. Ich habe darauf verzichtet, die erste Hälfte des Lebens darzustellen, weil ich glaube, dass es eine sommerliche Erfüllung für Hölderlin nicht geben konnte. In seinem "Weh mir" am Anfang der zweiten Strophe wird dies von Hölderlin auch bitter beklagt.
Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog
Schön ihn nieder; das Leid beugt ihn gewaltiger;
So durchlauf ich des Lebens
Bogen und kehre, woher ich kam.
Das Gedicht "Lebenslauf" beschreibt die Situation des alternden Menschen. Hierzu habe ich eine Farbradierung geschaffen, die den hoch aufstrebenden Geist der Jugend in der ersten Hälfte des Gedichts dem gebeugten in der zweiten Hälfte gegenüberstellt. Durch meine Farbwahl wird dieser Gegensatz noch verstärkt. Ein kräftiges Rot rückt die erste Lebenshälfte nach vorne und ein kaltes, dunkles Blau das Ende in die Ferne.
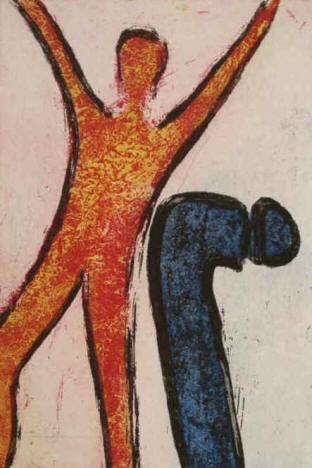
Farbradierung zu "Lebenslauf" von Friedrich
Hölderlin
Zusätzlich zu dieser Gegenüberstellung beider Hälften in der Farbradierung habe ich die Gefühle des nahenden Lebensendes in einer Kombination aus handgeschöpftem Papier und Radierung in reduzierter Form wiedergegeben:
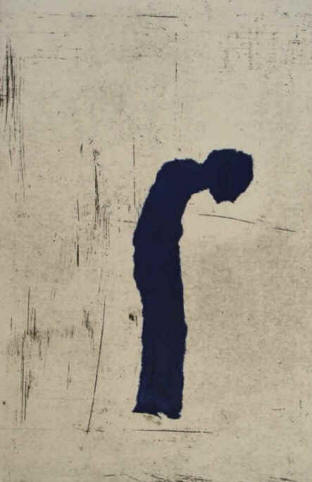
Radierung mit handgeschöpftem Papierobjekt von Elke Rehder
Der Tod des Empedokles ist ein unvollendetes Dramenprojekt von Friedrich
Hölderlin. Das Stück behandelt die letzten Lebenstage des
vorsokratischen Philosophen Empedokles aus Agrigent, der sich einer
Legende nach durch einen Sturz in den Ätna mit den Worten „Im freien
Tod, nach göttlichem Gesetz“ das Leben nahm.
Hölderlins hauptsächliche Quelle für den Empedokles-Stoff waren die
Lebensbeschreibungen, Lehren und Aussprüche hervorragender Philosophen
des antiken Philosophiehistorikers Diogenes Laertius. Das Stück entstand
in den Jahren 1797 bis 1800 und wurde erst nach dem Tod des Dichters
veröffentlicht. Die Hölderlin-Editoren haben drei Fassungen des Werks
aus den Handschriften rekonstruiert; außerdem sind mehrere Pläne,
Entwürfe und theoretische Schriften erhalten, die sich auf das Drama
beziehen. Hölderlin beschäftigte sich bereits während seiner Arbeit an
dem zuvor erschienenen Roman Hyperion mit diesem Stoff. Die Titelfigur
sagt an einer Stelle: „Gestern war ich auf dem Ätna droben. Da fiel der
große Sicilianer mir ein, der einst des Stundenzählens satt, vertraut
mit der Seele der Welt, in seiner kühnen Lebenslust sich da hinabwarf in
die herrlichen Flammen.“ Der erste Beleg für die Arbeit an dem Drama
selbst findet sich in einem Brief Hölderlins an seinen Bruder vom Sommer
1797. Darin heißt es: „Ich habe den ganz detaillierten Plan zu einem
Trauerspiele gemacht, dessen Stoff mich hinreißt.“ Dieser so genannte
„Frankfurter Plan“ ist erhalten geblieben; Hölderlin notierte ihn in
einem Schulheft des jungen Henry Gontard, dessen „Hofmeister“, also
Privatlehrer er war. Aus diesem Plan geht hervor, dass das Drama auf
fünf Akte angelegt war. Etwa zur selben Zeit entstand auch eine
dreistrophige, Empedokles betitelte alkäische Ode, in der Bedauern, aber
auch Bewunderung für dessen Heldenmut zum Ausdruck kommt. Veröffentlicht
wurde sie 1801 in dem Almanach Aglaia.
Friedrich Hölderlin arbeitete zwischen 1797 und 1800 an einem Trauerspiel
Der Tod des Empedokles, das unvollendet blieb; es entstanden drei
Entwürfe. Empedokles lebt in Harmonie mit einer „größeren“ Natur, in der
er sich wie ein Gott fühlt. Dadurch entsteht ein schroffer Gegensatz
zwischen ihm und seinen Mitbürgern, die sich nur ihren
Alltagsbedürfnissen widmen. Die Agrigenter wollen sich zwar seiner
Leitung unterstellen, aber nur im herkömmlichen politischen Sinn, indem
sie ihn zum König erheben; sie erkennen nicht, dass die Führung, die er
ihnen bieten könnte, geistiger Art ist. Die Königswürde lehnt er ab, da
sie nicht mehr zeitgemäß sei. Er fordert Abkehr von der Tradition und
eine radikale Neuorientierung mit der „göttlichen Natur“ als Leitbild.
Das Volk beharrt jedoch auf seiner gewohnten Denkweise. Empedokles
scheitert äußerlich, indem er aus seiner Heimatstadt verbannt wird, und
innerlich, indem sein Bund mit den Göttern zerbricht. Mit seinem Tod im
Ätna zieht er die Konsequenz daraus. Erst 1826 wurde der dritte Entwurf
des Trauerspiels gedruckt; 1846 erschienen alle drei Entwürfe in der
Gesamtausgabe Friedrich Hölderlins sämtliche Werke. 1805 brachte
Friedrich Wilhelm Sturz die erste moderne Edition der Fragmente des
Empedokles heraus.
Der Dichter Matthew Arnold veröffentlichte 1852 eine Gedichtsammlung
Empedocles on Etna and Other Poems. Das titelgebende Gedicht (dramatic
poem) besteht aus Dialogen. Wie schon Hölderlin lässt Arnold den
Philosophen im Ätna sterben; der Tod ist ein Moment der Freude und
erscheint als Akt der Befreiung.
Friedrich Nietzsche schätzte Empedokles und betrachtete ihn als Muster
eines tragischen Philosophen. Er plante eine Tragödie zu verfassen,
deren Held Empedokles sein sollte; Entwürfe aus dem Zeitraum 1870–71
sind überliefert.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff meinte, dass Empedokles’ Philosophie,
„obwohl sie wenig original und tief war, zu einer dauernden Macht
gelangte“; dies habe der Dichter durch seine „formale Kunst“ erreicht.
Romain Rolland verfasste 1918 einen Essay Empédocle d’Agrigente et l’âge
de la haine, der 1947 in deutscher Übersetzung erschien. Darin schildert
er Empedokles als den menschlichsten Vorsokratiker, dessen Dichtung ein
Gesang der Hoffnung und des Friedens sei.
1937 veröffentlichte Sigmund Freud seinen Aufsatz Die endliche und die
unendliche Analyse, worin er Empedokles als „eine der großartigsten und
merkwürdigsten Gestalten der griechischen Kulturgeschichte“ bezeichnet.
Freud vertritt dort die Ansicht, der antike Philosoph habe, indem er das
Prinzip des Streits als eigenständige Naturkraft einführte, den
Todestrieb entdeckt und sei damit ein Vorläufer der Psychoanalyse. Die
Psychoanalyse habe nach zweieinhalb Jahrtausenden die Theorie des
Empedokles neu entdeckt und „gewissermaßen biologisch unterbaut“, indem
sie den Destruktionstrieb auf den Todestrieb zurückführte, „den Drang
des Lebenden, zum Leblosen zurückzukehren“.
Bertolt Brecht schrieb 1935 das Erzählgedicht Der Schuh des Empedokles.
Darin präsentiert er neben der von Diogenes Laertios mitgeteilten
Fassung der Geschichte vom Tod im Ätna eine eigene Version. In Brechts
Darstellung bestieg Empedokles, als er wegen Altersgebrechen lebensmüde
war, den Vulkan und ließ, bevor er in den Krater sprang, einen seiner
abgetragenen ledernen Schuhe zurück. Damit wollte er erreichen, dass der
Schuh dort später gefunden würde und so die einsetzende Legendenbildung
zunichte gemacht würde.
Das 1971 uraufgeführte Stück Hölderlin von Peter Weiss befasst sich
ebenfalls mit der Thematik des Empedokles. Der Dichter Hölderlin
entwirft in ihm ein Stück im Stück; er schildert einen Empedokles der
sich als geistiger Führer ins Gebirge zurückzieht, um die Gesellschaft
zur Erneuerung zu führen. Kaum verbreitet sich die Sage von Empedokles,
ist „vom Widerstand der Sclaven in den Silberminen“ zu hören. Empedokles
steht spiegelbildlich im Umfeld der Erneuerung Agrigents für den
Hölderlin der französischen Revolution. Die Identifikation des
Hölderlins mit dem literarischen Vorbild des Empedokles gleicht
symmetrisch der Identifikation Peter Weiss’ mit dem Dichter Hölderlin.
(Angaben nach Quellen aus Wikipedia)
Empedokles
Das Leben suchst du, suchst, und es quillt und glänzt
Ein göttlich Feuer tief aus der Erde dir,
Und du in schauderndem Verlangen
Wirfst dich hinab, in des Aetna Flammen.
So schmelzt' im Weine Perlen der Übermut
Der Königin; und mochte sie doch! hättst du
Nur deinen Reichtum nicht, o Dichter,
Hin in den gärenden Kelch geopfert!
Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,
Die dich hinwegnahm, kühner Getöteter!
Und folgen möcht' ich in die Tiefe,
Hielte die Liebe mich nicht, dem Helden.
Der Tod des Empedokles wurde von Hölderlin auch als Drama in mehreren
Fassungen beschrieben. Die Sage vom Tode des im Jahre 483 in Sizilien geborenen
Philosophen Empedokles, der sich in den Krater des Vulkans Ätna stürzte, wird
bei Hölderlin zu einem religiösen Mysterium. Zu dem Gedicht "Empedokles" schuf
ich zuerst eine Farbradierung in Rot und Schwarz; eine stilisierte Ansicht eines
feuerspeienden Vulkans.
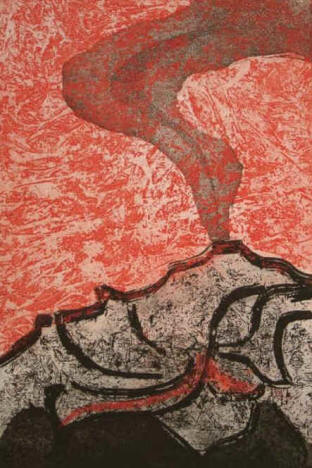
Der Vulkan Ätna.
Farbradierung von Elke Rehder zum Gedicht Empedokles von Friedrich Hölderlin
Das Thema ließ mich nicht los, so dass ich weiter daran arbeitete. Ich studierte in alten Büchern die Geologie des Ätnas und fertigte schließlich eine zweite Farbradierung, welche die Anordnung der verschiedenen Einzelkrater des Ätnas aus der Vogelperspektive zeigt. Diese abstrahierte Darstellung gleicht einem mystischen Vogelbildnis.

Der Vulkan Ätna aus der Vogelperspektive
nach einem alten Luftbild umgesetzt in eine Farbradierung zu Empedokles von Friedrich Hölderlin
Auf der Suche nach einer weiteren Reduktion entschied ich mich auch hier für eine kombinierte Arbeit aus handgeschöpftem Papier mit Radierung. Der rote Punkt symbolisiert eines der vier von Empedokles genannten Grundstoffe, das trockene und warme Feuer (Heraklit).
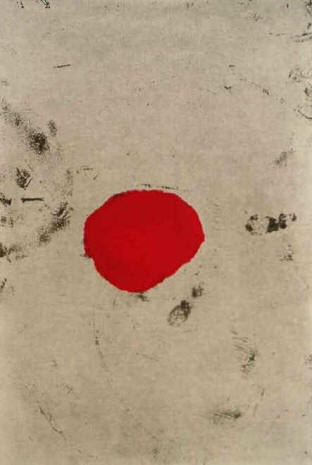
Das Auge des Vulkans.
Radierung mit handgeschöpftem Papierobjekt von Elke Rehder
zu dem Gedicht "Empedokles" von Friedrich Hölderlin
Empedokles (um 495 v. Chr. in Akragas, dem heutigen Agrigent auf Sizilien;
† um 435 v. Chr. wohl auf der Peloponnes) war ein antiker griechischer
Philosoph (Vorsokratiker), Politiker, Redner und Dichter. Unklar ist, ob
die Behauptungen zutreffen, wonach er sich auch als Arzt, Magier und
Wahrsager betätigte. Zahlreiche Geschichten über sein Leben und seinen
Tod tragen legendenhafte Züge. Als Politiker war er in seiner
Heimatstadt Akragas umstritten und musste ins Exil gehen, aus dem er
nicht mehr zurückkehrte.
Die Philosophie des Empedokles ist in seinen beiden nur fragmentarisch
erhaltenen Gedichten – dem Lehrgedicht über die Natur und den
„Reinigungen“ – dargelegt. Wie bei den Vorsokratikern üblich befasste er
sich mit der Frage der Weltentstehung (Kosmogonie) und versuchte die
Ordnung und Beschaffenheit des Weltalls zu klären (Kosmologie). In
diesem Zusammenhang entwickelte er eine von mythischem Denken geprägte
physikalische und biologische Theorie, zu der auch eine Vorstellung von
der Entstehung des Lebens auf der Erde und der Evolution der Lebewesen
gehörte. Er führte die Lehre von den vier Urstoffen
(Vier-Elemente-Lehre) ein, die für das naturwissenschaftliche Weltbild
der Antike maßgeblich wurde und auch die Medizin beeinflusste.
Eine zentrale Rolle spielen in seiner Philosophie ethische und religiöse
Überzeugungen, die eng mit seiner Lehre von der Reinkarnation verknüpft
sind; im Mittelpunkt steht die Forderung nach Gewaltlosigkeit. Die frei
erfundene Legende von seinem Tod im Vulkan Ätna beschäftigte die
Fantasie der Nachwelt bis in die Moderne.
Die Hauptquelle für das Leben des Empedokles ist das ihm gewidmete Kapitel
im achten Buch der Philosophenbiografien des Doxographen Diogenes
Laertios. Diogenes beruft sich für seine Angaben über Empedokles auf 22
heute verlorene Schriften verschiedener Autoren, die ihm aber
möglicherweise zum Teil nur aus Zitaten in späterer Literatur bekannt
waren. Seinen Quellen entnahm er insbesondere anekdotisches Material.
Die überlieferten Geschichten dienen großenteils der mitunter
drastischen Veranschaulichung von angeblichen oder tatsächlichen
Charakterzügen oder Fähigkeiten des Philosophen. Manche Anekdoten sind
frei erfunden, viele wirken zumindest sagenhaft ausgeschmückt. Manchmal
ist – wie bei Heraklit – erkennbar, dass der Urheber einer Behauptung
oder Geschichte beabsichtigte, den Philosophen lächerlich zu machen.
Einige Angaben über Empedokles’ Leben sind möglicherweise aus einer
biografischen Interpretation von Stellen in seiner Dichtung entstanden.
Tatsächlich können einzelne Bemerkungen des Dichters einen
autobiografischen Hintergrund haben, doch ist bei derartigen Folgerungen
Vorsicht geboten. Generell ist die Glaubwürdigkeit der Überlieferung
umstritten.
Da die Lehrdichtung des Empedokles nur bruchstückhaft erhalten ist, sind
auch Werke anderer Autoren wichtige Quellen für seine Lehre. Eine Reihe
von Informationen liefern Aristoteles und Plutarch sowie
Aristoteles-Kommentatoren (insbesondere Simplikios). Plutarchs
umfangreiche Monographie über Empedokles ist bis auf ein Fragment
verloren, doch äußert er sich auch in seinen erhaltenen Schriften über
den Vorsokratiker und zitiert ihn.
Die Geburt des Empedokles lässt sich nur ungefähr datieren; da er etwas
jünger war als sein Zeitgenosse Anaxagoras, fällt sie wohl in die ersten
Jahre des 5. Jahrhunderts. Er stammte aus einer vornehmen und reichen
Familie seiner Heimatstadt Akragas. Sein Großvater, der ebenfalls
Empedokles hieß, war Pferdezüchter und Sieger bei den Olympischen
Spielen von 496. Sein Vater Meton war ein prominenter Politiker. Nach
dem Tode des um 472 v. Chr. gestorbenen Tyrannen Theron begannen in
Akragas unruhige Zeiten. Der Nachfolger des Tyrannen, sein Sohn
Thrasydaios, musste nach nur einjähriger Herrschaft ins Exil gehen. Bei
dieser politischen Neuorientierung der Stadt spielte Meton auf der Seite
der Tyrannengegner eine führende Rolle. Angeblich wurde Empedokles die
Königswürde angeboten, die er jedoch ablehnte. Sicher ist, dass sich die
Idee einer demokratischen Staatsordnung durchsetzte. Empedokles
engagierte sich auf der Seite der Demokratiebefürworter und trat
energisch gegen Bestrebungen auf, die nach seiner Einschätzung auf eine
Tyrannenherrschaft abzielten. Er erreichte die Auflösung einer
Organisation, die als „Versammlung der Tausend“ bezeichnet wurde und
wohl oligarchische Ziele verfolgte. Eine von Diogenes Laertios
mitgeteilte Anekdote über Todesurteile, die er veranlasst haben soll,
ist allerdings unglaubwürdig; es handelt sich wohl um eine Erfindung
eines Komödiendichters. Anscheinend war Empedokles ein begabter Redner,
Aristoteles bezeichnete ihn sogar als Erfinder der Rhetorik.
Empedokles’ Verhältnis zu älteren und zeitgenössischen Philosophen ist
schwer zu bestimmen. In der Antike galt er als Schüler des Pythagoras
oder von frühen Pythagoreern. Diese Annahme war wegen der Verwandtschaft
seiner Lehre mit pythagoreischem Gedankengut naheliegend. Ein direktes
Schülerverhältnis zu Pythagoras ist allerdings aus chronologischem Grund
ausgeschlossen. Außerdem bezeichnet ihn eine antike Überlieferung als
Schüler des Parmenides, dessen Lehre ihn jedenfalls beeinflusst hat.
Der biografischen Überlieferung zufolge war Empedokles auch ein
erfolgreicher Arzt. Er soll eine Scheintote geheilt haben, die von ihren
Ärzten bereits aufgegeben worden war. Ob in dieser legendenhaft
ausgeschmückten Geschichte von einer spektakulären Heilung ein
historischer Kern steckt, ist unklar. Dass Empedokles
Gesundheitsberatung erteilte, erwähnt er selbst. In einer Aufzählung der
vier vornehmsten Berufe nennt er die Ärzte neben Weissagern, Dichtern
und Fürsten; das ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass er den
Arztberuf selbst ausgeübt hat. Dazu passt auch sein ausgeprägtes
Interesse an biologischen Themen.
Wegen eines politischen Konflikts hielt sich Empedokles im Exil auf; als
er nach Akragas zurückkehren wollte, verhinderten dies mächtige Gegner.
Der von Diogenes Laertios zitierte Geschichtsschreiber Timaios von
Tauromenion berichtet, der Philosoph sei nach Griechenland ausgewandert
und habe sich auf der Peloponnes niedergelassen; von dort sei er nicht
mehr zurückgekehrt. Mit Berufung auf Aristoteles und Herakleides
Pontikos schreibt Diogenes, Empedokles sei sechzig Jahre alt geworden;
daraus folgt, dass sein Tod wohl um die Mitte der dreißiger Jahre des 5.
Jahrhunderts zu datieren ist. Die Todesumstände sind unbekannt. Die
populäre Legende, wonach Empedokles sich in den Vulkan Ätna stürzte, ist
freie Erfindung.
Von Empedokles sind keine Bildnisse erhalten. Diogenes Laertios
berichtet von einer Statue des Philosophen in Akragas, die später in Rom
aufgestellt worden sei, sowie von Gemälden.
Empedokles schrieb eine Anzahl von Werken, die großenteils verloren sind.
Erhalten sind Fragmente seiner beiden bekanntesten Dichtungen, des
philosophischen Lehrgedichts über die Natur und der „Reinigungen“
(Katharmoí), die beide in Hexametern abgefasst waren. Die überlieferten
Bezeichnungen des Naturgedichts – „Über die Natur“ (Peri phýseōs), „Über
die Natur des Seienden“ (Peri phýseōs tōn óntōn) oder „Physik“ (Physiká)
– waren ursprünglich nur Angaben des Themas; sie waren nicht als
Werktitel im später geläufigen Sinne gemeint, denn vom Verfasser
verbindlich festgelegte Titel philosophischer Werke waren damals noch
nicht üblich. Die herkömmliche, weiterhin vorherrschende Lehrmeinung
lautet, dass das Naturgedicht und die „Reinigungen“ zwei
unterschiedliche Werke sind, von denen das eine in erster Linie die
Naturphilosophie behandelt, das andere primär einem religiösen Zweck
dient. Seit 1987 wird in der Forschung aber auch die Ansicht vertreten,
es handle sich um nur ein Werk. Ausdrücklich bezeugt ist die Existenz
zweier verschiedener Gedichte nur bei Diogenes Laertios. Die Hypothese,
wonach es sich um ein einziges Gedicht handelt, hat sich aber nicht
durchsetzen können.
Den Gesamtumfang der beiden Gedichte gibt Diogenes Laertios mit rund
5000 Versen an. Erhalten sind insgesamt etwa 500 Verse; sie sind
größtenteils nur aus Zitaten in späterer antiker Literatur bekannt, doch
sind darunter auch einige Dutzend Verse bzw. Versteile aus dem ersten
Buch des Naturgedichts, die nur im Straßburger Empedokles-Papyrus
stehen. Bei diesem aus dem späten 1. Jahrhundert stammenden Papyrus
handelt es sich um 52 Bruchstücke einer Papyrusrolle, die als Unterlage
eines aufgeklebten Schmuckkragens aus Kupferblech dienten. Der Kragen
wurde schon 1904 von dem Archäologen Otto Rubensohn erworben, aber erst
1992 sind die Papyrus-Bruchstücke als Teil von Empedokles’ Werk
identifiziert worden.
Die Verteilung der erhaltenen Fragmente auf die beiden großen Gedichte
ist teils gesichert, teils hypothetisch. Schwierig ist die Bestimmung
der Reihenfolge der Fragmente und damit die zumindest teilweise
Rekonstruktion des Aufbaus der beiden Werke. In den „Reinigungen“
berichtet der Ich-Erzähler von dem furchtbaren Schicksal, das er sich
durch seine Untaten zugezogen hat; seine für mündlichen Vortrag gedachte
Schilderung soll das Publikum entsetzen und erschüttern. Nach einem
antiken Bericht hat Empedokles die „Reinigungen“ während der Olympischen
Spiele öffentlich von einem berühmten Rhapsoden vortragen lassen, um
seine Lehre auf diesem Weg bekannt zu machen. Im Naturgedicht wendet
sich der Philosoph direkt an seinen Schüler Pausanias, dem er das Werk
gewidmet hat, und erteilt ihm Belehrungen. Pausanias soll sein Geliebter
gewesen sein, wie Diogenes Laertios mit Berufung auf Aristippos von
Kyrene und Satyros von Kallatis berichtet.
Diogenes Laertios teilt mit, Empedokles habe laut einer verlorenen
Schrift des Aristoteles politische Abhandlungen geschrieben, und zu
seinen Werken gehöre auch eine medizinische Schrift (Iatrikós lógos),
die rund 600 Verse (oder Zeilen) umfasst habe. In der Suda, einer
byzantinischen Enzyklopädie, wird die medizinische Schrift als Prosawerk
bezeichnet. Auch Tragödien wurden Empedokles in der Antike
zugeschrieben; deren Verfasser war möglicherweise ein gleichnamiger
Enkel des Philosophen, der in der Suda als Tragödiendichter erwähnt
wird. Ferner stammten von Empedokles ein Gedicht über die
Hellespont-Überquerung des persischen Königs Xerxes I. und ein Hymnus
auf den Gott Apollon. Man hat versucht, Reste dieser Gedichte zu
identifizieren; diese Hypothesen haben aber wenig Anklang gefunden.
Empedokles entwickelt seine Philosophie in Auseinandersetzung mit dem
Denken des Parmenides, den er aber in den erhaltenen Versen nicht nennt.
Den Kern seiner Weltdeutung bildet die Konzeption eines ewigen
Kreislaufs. Die Naturlehre, die er vorlegt, ist der philosophische
Ausdruck des mythischen Weltbilds, zu dem er sich bekennt. In das
naturphilosophische System eingebettet ist eine von religiösem
Erlösungsstreben geprägte Ethik.
Umstritten ist die Frage nach der Einheitlichkeit von Empedokles’ Lehre
bzw. nach einer möglichen Entwicklung seines Denkens, deren Etappen sich
in den beiden Gedichten spiegeln.
Zur Zeit des Empedokles lagen in der griechischen Philosophie zwei
gegensätzliche Weltdeutungen vor, die Lehre des Parmenides und die
Heraklits. Parmenides billigt nur dem Unentstandenen, Vollkommenen und
Unveränderlichen Wirklichkeit zu, da er Sein und Entstehen für
unvereinbar hält. Für Heraklit sind Sein und Werden unauflöslich
verknüpft und bedingen einander.
Empedokles bemüht sich um eine Lösung, die beide Ansätze integriert. Er
akzeptiert das Werdende und Vergehende als real, hält aber zugleich an
dem Konzept eines keiner Veränderung unterworfenen Seins fest. Träger
des Seins sind für ihn die vier Urstoffe Feuer, Wasser, Luft und Erde.
Damit wird er zum Begründer der Vier-Elemente-Lehre, doch bezeichnet er
die Urstoffe nicht mit dem später gängigen Begriff „Elemente“
(stoicheía), sondern nennt sie „Wurzeln“ (rhizōmata). Die Urstoffe sind
qualitativ und quantitativ absolut unveränderlich und erfüllen den
gesamten Raum lückenlos; ein Vakuum kann es nicht geben. Sie sind
unentstanden und unvergänglich und können sich auch nicht – wie bei
Heraklit – ineinander umwandeln. Sie sind also nicht auf einen einzigen
Urstoff oder ein Urprinzip (archḗ) zurückführbar, sondern gleichrangig.
Damit erfüllen sie die Kriterien eines als Gegensatz zum Werden
aufgefassten Seins. Es gibt keine Entstehung aus dem Nichts und keine
absolute Vernichtung. Die vier Urstoffe weisen die gleiche konstante
Gesamtmasse auf. Alles, was von einem Betrachter als Veränderung
wahrgenommen wird, beruht auf dem Positionswechsel kleiner
Stoffteilchen, der die jeweils an einem Ort gegebenen
Mischungsverhältnisse der Urstoffe ändert. Die Änderung der Mischung
manifestiert sich als Wandel der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften
physischer Objekte. Mit dieser Theorie hat Empedokles erstmals das
Konzept des Aufbaus der gesamten physischen Welt aus einer beschränkten
Zahl von stabilen Elementen in die Naturphilosophie eingeführt. Ob er
die Urstoffe für beliebig teilbar hielt oder von kleinsten
Mengeneinheiten ausging, ist aus den erhaltenen Fragmenten seines
Lehrgedichts nicht ersichtlich.
Die Lehre von den vier Urstoffen verbindet Empedokles mit der
griechischen Mythologie, indem er die Stoffe den Gottheiten Zeus, Here
(Hera), Aidoneus (Hades) und Nestis zuordnet. Bei Nestis handelt es sich
unzweifelhaft um die Wassergottheit; Empedokles hat sie anscheinend mit
Persephone identifiziert. Die Zuweisung der drei übrigen Elemente geht
aus den erhaltenen Fragmenten von Empedokles’ Dichtung nicht klar hervor
und ist strittig. Im Altertum wurde nicht bezweifelt, dass mit Zeus der
Feuergott gemeint ist; unklar war nur, ob Here für die Luft und Aidoneus
für die Erde steht oder umgekehrt. In der modernen Forschung wird schon
seit dem 19. Jahrhundert auch die traditionelle Zuordnung des Zeus in
Zweifel gezogen. Eine Reihe von Gelehrten, darunter vor allem Peter
Kingsley, treten für eine Hypothese ein, die den Feuergott mit Aidoneus
identifiziert, Zeus mit der Luft und Here mit der Erde.
Auch bei der Bestimmung der Ursachen für den Ortswechsel von
Stoffteilchen, auf den Empedokles jede Veränderung zurückführt, greift
er auf ein mythisches Konzept zurück. Er nimmt zwei einander
entgegenwirkende bewegende Kräfte an, eine anziehende und vereinigende
und eine abstoßende und trennende. Die vereinigende Kraft nennt er
philótēs (Liebe, Freundschaft), die trennende neíkos (Streit). Sie
streben unablässig danach, einander zu verdrängen. Aus ihrem endlosen
wechselhaften Kampf resultieren alle Vorgänge im Universum
einschließlich der menschlichen Schicksale.
Mit diesem System hebt Empedokles den für Parmenides grundlegenden
Unterschied zwischen dem Wirklichen, unveränderlich Seienden und der
trügerischen Erscheinungswelt des Vergänglichen auf. Für ihn ist die
Welt in ihrer Gesamtheit das Wirkliche, und diese Wirklichkeit ergibt
sich aus den sechs Prinzipien (vier Urstoffe und zwei Kräfte) und deren
Funktionszusammenhang.
Während die vier Urstoffe als solche qualitativ und quantitativ
unveränderlich sind, unterliegt der Einfluss der bewegenden Kräfte Liebe
und Streit im Lauf der Zeit starken Veränderungen. Dabei handelt es sich
um einen zyklischen Wandel. Wenn die Macht der Liebe in der Welt ihre
höchste Entfaltung erreicht hat, ergibt sich ein Höchstmaß an
Vereinigung, die stärkste Durchmischung der Elemente und damit die
größte erreichbare Homogenität der Welt. Der Kosmos befindet sich in
einem Ruhezustand. Die überall gleichmäßig vermischten Elemente bilden
eine einheitliche göttliche Kugel (sphaíros); der Streit ist bis an den
äußersten Rand des Universums abgedrängt. Die Homogenität der Kugel ist
aber nicht absolut, da jedes der Elemente sein Eigendasein in der
Mischung bewahrt. Mit der Vorstellung eines kugelförmigen Gottes
Sphairos – die Kugel galt wegen der Kugelsymmetrie als vollkommener
Körper – wendet sich Empedokles gegen anthropomorphe
Gottesvorstellungen. Der Kugelgott, der mit dem All in dessen
Ruhezustand identisch ist, ist ein fühlendes Lebewesen; er freut sich
über seine Einheit. Dieser von der Liebe erzeugte Idealzustand der Welt
kann aber nur zeitweilig bewahrt werden. Dann muss ein Umschwung
eintreten: Die verdrängte Macht des Streits beginnt zu erstarken, sie
nimmt von der Peripherie her kontinuierlich zu und bewirkt eine
zunehmende Trennung der Elemente. Graduell gewinnt die Trennungskraft
die Oberhand und erlangt schließlich ihre höchstmögliche Macht, wenn die
vier Elemente in vier homogene, konzentrisch umeinander geschichtete
Massen getrennt sind, die rasch rotieren. Dieser Zustand, mit dem die
Verdrängung der Liebe ihr Maximum erreicht hat, bleibt eine bestimmte
Zeit lang stabil. Dann kommt es zwangsläufig erneut zum Umschwung. Die
in die Mitte des Universums zurückgedrängte Liebe macht sich von dort
aus wieder bemerkbar, verdrängt den Streit nach außen und sorgt für
zunehmende Vermischung der Elemente und Verlangsamung ihrer Bewegung.
Dieser Kreislauf vollzieht sich nach einer unabänderlichen
Gesetzmäßigkeit der Natur.
Aus dem Kreislauf ergibt sich die Geschichte des Universums, in der sich
somit vier Phasen unterscheiden lassen: die Periode der Vorherrschaft
der Liebe, die Periode der zunehmenden Macht des Streits, die Periode
der Vorherrschaft des Streits und die Periode der zunehmenden Macht der
Liebe. Empedokles ordnet seine eigene Epoche der zweiten Phase zu, in
welcher die trennende und die vereinende Kraft miteinander ringen und
der Streit die Oberhand gewinnt. Auf diese Phase des Zyklus geht er
ausführlich ein. Aus der Interaktion zwischen der zurückweichenden Liebe
und dem vordringenden Streit ist phasenweise der gegenwärtige Kosmos mit
seiner Vielfalt verschiedenartiger Phänomene entstanden. Der
Trennungsvorgang hat damit eingesetzt, dass zunächst Luft, die
Empedokles aithḗr nennt, durch eine zentrifugale Wirbelbewegung
abgesondert und an die Oberfläche der Weltkugel getrieben wurde. Dort
bildete sie eine durchsichtige Umhüllung. Dann trennte sich in der Kugel
ein heller, vom Feuer geprägter Außenbereich von einem dunklen inneren
mit eingesprengten Feuerteilchen. In der Mitte des dunklen Innenbereichs
bildete sich die von Feuchtigkeit durchdrungene Erde. Danach sonderten
sich Erde und Wasser voneinander ab, indem das Wasser aus der Erde
hervorsprudelte. Schließlich löste sich aus dem Wasser Luft und stieg
auf; so entstand die irdische Atemluft. Damit hat die Welt ihre den
Menschen vertraute Gestalt erreicht.
Die Einzelheiten des zyklischen Ablaufs und seine Bedeutung im Rahmen
der Philosophie des Empedokles sind in der Forschung umstritten; unklar
ist insbesondere, ob sowohl in der zweiten als auch in der vierten Phase
eine Weltschöpfung und ein Weltuntergang samt Entstehung und Vernichtung
der Lebewesen stattfinden und ob dem Streit dabei eine schöpferische
Rolle zukommt. Außerdem ist sogar der kosmische Charakter des Zyklus von
einigen Forschern bestritten worden; Uvo Hölscher trug 1965 die
Hypothese vor, Empedokles habe vielmehr einen Lebenszyklus gemeint.
Diese zeitweilig populäre Interpretation hat sich aber nicht
durchgesetzt.
Bei den leuchtenden Himmelskörpern handelt es sich um örtliche
Zusammenballungen des Feuerstoffs. Dazu gehört die Sonne, deren Licht
vom Mond reflektiert wird. Die Behauptung des Doxographen Aëtios,
Empedokles habe das Sonnenlicht als Reflexion eines von der feurigen
Hemisphäre des Kosmos ausgehenden Lichts aufgefasst, beruht auf einem
Missverständnis.
Ein Sonderaspekt des kosmischen Prozesses ist die Entstehung der belebten
Körper, die Empedokles mit seiner phylogenetischen Theorie beschreibt.
Die Lebewesen fasst er wie alle physischen Objekte als Gemische aus den
vier Elementen auf. Die Unterschiede zwischen den Arten und den
Individuen ergeben sich im Rahmen seiner Theorie aus der Verschiedenheit
der jeweiligen Mischungsverhältnisse. Aus der feuchten Erde bildeten
sich unter der Einwirkung der verbindenden Liebeskraft die ersten
Pflanzen und Tiere. Anfangs entstanden keine ganzen Tiere, sondern nur
einzelne Bestandteile von Tierkörpern, die sich zu unförmigen Gebilden
vereinigten, welche unstabil waren und zerfielen. Später formten sich
zweckmäßig aufgebaute Organismen, die aber zunächst noch nicht über
Geschlechtsorgane verfügten. Erst in der letzten Phase kam es zur
geschlechtlichen Differenzierung. Dem Zufall weist Empedokles eine
wichtige Rolle bei diesen Vorgängen der biologischen Evolution zu.
Die künftige restlose Trennung der Elemente durch den unausweichlichen
Sieg des Streits muss zur Vernichtung aller belebten Körper führen,
ebenso wie auch in der Phase der völligen Dominanz der Liebe und
Durchmischung der Elemente kein individuelles Leben mehr möglich ist.
Einzelnen biologischen Funktionen wendet sich Empedokles mit großem
Interesse zu. Unter anderem erörtert er Zeugung, embryonale Entwicklung,
Atmung und Sinneswahrnehmung. Das Denken und die Einsicht lokalisiert er
hauptsächlich im Blut, das sich in der Umgebung des Herzens befindet,
denn im Blut sei die von der Liebe bewirkte Durchmischung der Urstoffe
am stärksten. Die Sinneswahrnehmung erklärt er nach dem Prinzip des
Erfassens von Gleichem durch Gleiches; da die Sinnesorgane aus den
gleichen Elementen bestehen wie die Wahrnehmungsobjekte, können sie
diese adäquat abbilden. Dazu ist ein körperlicher Kontakt erforderlich;
materielle Ausströmungen der Wahrnehmungsobjekte erreichen die
Wahrnehmungsorgane und treten durch Poren in den Körper des
Wahrnehmenden ein. Die Art der Sinneswahrnehmung (optisch, akustisch
usw.) hängt von der Größe der Poren des Sinnesorgans ab, die jeweils
einer bestimmten Art von Ausströmung des Wahrnehmungsobjekts angepasst
ist. Sind die Poren für bestimmte Partikel zu klein, so ist deren
Einströmen unmöglich, sind sie zu groß, so kommt es beim Einströmen
nicht zum erforderlichen Kontakt. Hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit
der von den Sinnesorganen vermittelten Informationen verwarf Empedokles
die radikal ablehnende Position des Parmenides und entschied sich für
den gemäßigten Standpunkt, man solle den Sinnen vertrauen, insoweit die
von ihnen gelieferten Daten klar seien.
Seine Theorie der Atmung veranschaulicht Empedokles durch einen
Vergleich mit einem Wasserheber (Klepsydra). Er erklärt die Atmung durch
Bewegungen des Bluts. Indem das Blut sich zurückzieht, gibt es der Luft
Raum und lässt sie dadurch einströmen. Strömt die Luft aus, nimmt das
Blut wieder ihren Platz ein. So entsteht der Wechsel von Ein- und
Ausatmen. Umstritten ist, ob Empedokles die Hautatmung oder die
Nasenatmung oder beides meint.
Empedokles ist der Überzeugung, dass sich Unrecht und Gewalttaten an ihren Urhebern rächen. Dies geschieht im Rahmen der Reinkarnation, der hier die Funktion einer Strafe zukommt. Das schuldig gewordene Individuum erleidet in aufeinanderfolgenden Leben schlimme Schicksale. Mit dieser Lehre knüpft Empedokles an ein orphisches und pythagoreisches Konzept an.
Am Anfang eines irdischen Daseinszyklus steht für Empedokles eine schwere
Verfehlung der betreffenden Person, die ursprünglich ein seliger Gott
war und als daímon („Dämon“) bezeichnet wird. Der Übeltäter muss die
Götterwelt verlassen und wird zur Strafe auf die Erde in ein langes Exil
geschickt. Dort muss er eine Reihe von Leben mit unterschiedlichen
Körpern durchlaufen.
Empedokles schildert auch einen einstigen harmonischen, konfliktfreien
Idealzustand der Menschheit und ihrer Umwelt in einer Epoche, als die
ständig wachsende Macht des Streits noch geringer war. Damit knüpft er
an die Vorstellung des von Hesiod beschriebenen vergangenen Goldenen
Zeitalters an. Die traditionelle, von Hesiod überlieferte Auffassung,
wonach der Gott Kronos im Goldenen Zeitalter der Herrscher war, lehnt
Empedokles jedoch ausdrücklich ab. Er schreibt, damals habe nicht Zeus
oder Kronos oder Poseidon regiert, sondern die Liebesgöttin Kypris
(Aphrodite). Die Tieropfer, die Empedokles verabscheut, habe es damals
nicht gegeben; das Töten und der Verzehr von getöteten Tieren sei als
„die größte Befleckung“ betrachtet worden.
Da der naturgemäße Urzustand für Empedokles mit völliger Enthaltung vom
Blutvergießen und vom Verzehr getöteter Tiere verbunden ist, ruft er
eindringlich zur Gewaltlosigkeit auch gegenüber der Tierwelt auf.
Mit Begeisterung verkündet Empedokles seine Botschaft von der möglichen
Rückentwicklung des Menschen zum Gott, welcher der verbannte „Dämon“
einst war, bevor er aus dem Reich der Glückseligen vertrieben wurde.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Verwirklichung dieses Ziels
im Rahmen des zyklischen Weltbilds des Naturgedichts nicht die Erlangung
eines endgültigen, ewigen Zustands bedeuten kann. Auch die Götter sind
bei Empedokles vergänglich. Ihre Unsterblichkeit ist für ihn nicht wie
für Homer ein ewiger Zustand, sondern befristet; das Unsterbliche kehrt
wieder in den Zustand der Sterblichkeit zurück. In einem begrenzten,
geschlossenen System, das auf der ewigen Wiederholung eines
gesetzmäßigen Kreislaufs beruht, muss notwendigerweise auf Liebe Streit
und auf jeden Aufstieg ein Abstieg folgen. (Quelle: Wikipedia)
![]()
Inhaber Elke Rehder
Blumenstr. 19
22885 Barsbüttel
USt-IdNr. DE172804871
Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail: 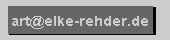
Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.
|
|